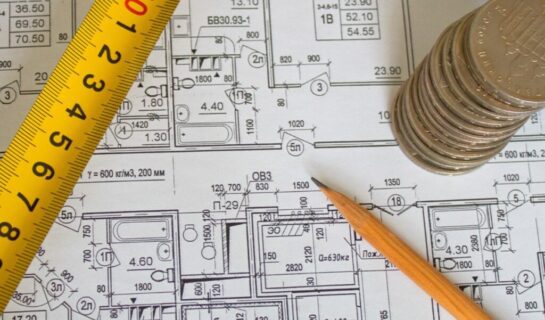Übersicht
- 1 Das Wichtigste: Kurz & knapp
- 2 Kaltakquise am Telefon: Bundesverwaltungsgericht zieht klare Grenzen für Werbeanrufe bei Unternehmen
- 3 Der Fall: Edelmetall-Ankauf per Telefon und der lange Weg durch die Instanzen
- 4 Die Kernfragen vor dem Bundesverwaltungsgericht
- 5 Die zentralen Entscheidungsgründe – verständlich erklärt
- 5.1 1. Wiederaufgreifen des Verfahrens: DSGVO als Rechtsänderung, aber ohne Vorteil für die Klägerin
- 5.2 2. Datenschutzrechtliche Bewertung: Art. 6 Abs. 1 Unterabs. 1 Buchst. f DSGVO als maßgebliche Norm
- 5.3 3. Der Knackpunkt: „Berechtigtes Interesse“ und die Verbindung zum Wettbewerbsrecht (§ 7 UWG)
- 5.4 4. Keine mutmaßliche Einwilligung der Zahnärzte
- 5.5 5. Folge: kein berechtigtes Interesse, keine rechtmäßige Datenverarbeitung
- 5.6 6. Kein Ermessensfehler der Behörde
- 6 Einordnung und Hintergrund: Das Spannungsfeld Datenschutz und Direktmarketing
- 7 Praktische Relevanz & Ausblick: Was bedeutet das für Sie?
- 8 Häufig gestellte Fragen zum Thema Kaltakquise und Telefonwerbung nach dem BVerwG-Urteil
- 9 Häufig gestellte Fragen (FAQ)
- 9.1 Darf ich als Unternehmen jetzt überhaupt keine anderen Firmen mehr zu Werbezwecken anrufen, wenn ich deren Nummer z.B. aus einem Branchenbuch habe?
- 9.2 Was genau bedeutet „mutmaßliche Einwilligung“ im B2B-Bereich und wie kann ich als anrufendes Unternehmen sicher sein, dass diese vorliegt?
- 9.3 Die Klägerin berief sich auf ihr „berechtigtes Interesse“ nach der DSGVO. Warum hat ihr das vor Gericht nicht geholfen?
- 9.4 Welche Konsequenzen drohen mir als Unternehmer, wenn ich mich nicht an diese Regeln halte und trotzdem Kaltakquise bei anderen Firmen ohne deren Einwilligung betreibe?
- 9.5 Ich bin selbst Freiberufler. Gilt dieser Schutz vor unerwünschten Werbeanrufen auch für mich, oder nur für größere Unternehmen?

Das Wichtigste: Kurz & knapp
- Unternehmen dürfen andere Unternehmen in Deutschland nur sehr eingeschränkt ungefragt zu Werbezwecken anrufen. Das Bundesverwaltungsgericht hat hier klare Grenzen gesetzt.
- Betroffen sind alle Firmen, die Telefonwerbung bei anderen Firmen betreiben, und die Firmen, die solche Anrufe erhalten.
- Kontaktdaten, die öffentlich sind (z.B. aus dem Internet oder Branchenbüchern), dürfen nicht einfach für Werbeanrufe genutzt werden.
- Sie brauchen fast immer eine Zustimmung des angerufenen Unternehmens, auch wenn es sich um geschäftliche Kontakte handelt.
- Das Gericht hat entschieden, dass Datenschutzrecht und Wettbewerbsrecht zusammen betrachtet werden müssen. Ein Interesse an Daten für Werbung ist nicht „berechtigt“, wenn die Werbung selbst verboten ist.
- Wer gegen die Regeln verstößt, riskiert Bußgelder (wegen Datenschutz) und Abmahnungen (wegen unlauterem Wettbewerb).
Quelle: Bundesverwaltungsgericht Urteil Az.: 6 C 3.23 vom 29. Januar 2025
Kaltakquise am Telefon: Bundesverwaltungsgericht zieht klare Grenzen für Werbeanrufe bei Unternehmen
Ein aktuelles Urteil des Bundesverwaltungsgerichts (BVerwG) vom 29. Januar 2025 (Az. 6 C 3.23) hat weitreichende Bedeutung für Unternehmen, die Telefonwerbung zur Kundengewinnung nutzen. Im Kern bestätigt das Gericht, dass die umstrittene Praxis der Kaltakquise per Telefon auch gegenüber anderen Unternehmen strengen Regeln unterliegt.
Selbst wenn Kontaktdaten öffentlich zugänglich sind, dürfen diese nicht ohne Weiteres für Werbeanrufe genutzt werden, wenn keine Einwilligung vorliegt. Das Urteil verdeutlicht das enge Zusammenspiel zwischen Datenschutzrecht (DSGVO) und Wettbewerbsrecht (UWG) und beantwortet die Frage: Wann ist ein Werbeanruf noch legitim und wann wird er zur unzulässigen Belästigung?
Für viele Unternehmen ist die telefonische Kontaktaufnahme ein etablierter Weg, um neue Kunden zu gewinnen oder Geschäftsbeziehungen anzubahnen. Doch nicht jeder Anruf ist willkommen, und die rechtlichen Hürden sind spätestens seit Inkrafttreten der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) höher geworden. Der Fall einer Firma, die Edelmetallreste von Zahnarztpraxen ankaufen wollte und dafür Ärger mit der Datenschutzbehörde bekam, landete nun vor dem höchsten deutschen Verwaltungsgericht und liefert wichtige Klarstellungen.
Der Fall: Edelmetall-Ankauf per Telefon und der lange Weg durch die Instanzen
Worum ging es im Kern?
Eine Unternehmerin hatte ein Geschäftsmodell entwickelt, das auf dem Ankauf von Edelmetallresten, wie sie beispielsweise bei zahnärztlichen Behandlungen anfallen (z.B. alte Goldkronen), von Zahnarztpraxen basiert. Um potenzielle Verkäufer zu finden, sammelte sie systematisch Kontaktdaten von Zahnarztpraxen aus öffentlich zugänglichen Quellen, wie den Gelben Seiten. Diese Daten – Name und Vorname des Praxisinhabers, Praxisanschrift und Telefonnummer – speicherte sie in einer Datenbank.
Anschließend nutzte die Klägerin diese Daten, um die Zahnarztpraxen ungefragt telefonisch zu kontaktieren. Ziel dieser Anrufe war es, zu erfragen, ob die Praxisinhaber Edelmetalle an sie verkaufen möchten. Im ersten Telefonat erläuterte sie zudem ihre Dienstleistung und das mögliche weitere Vorgehen bei Interesse.
Dieser Fall ist typisch für Situationen, in denen Unternehmen versuchen, über Kaltakquise neue Geschäftspartner zu gewinnen. Die menschliche Dimension zeigt sich oft in der Reaktion der Angerufenen: Während manche vielleicht ein Angebot begrüßen, fühlen sich andere durch unaufgeforderte Werbeanrufe gestört oder in ihrer Arbeit unterbrochen, selbst wenn es sich um geschäftliche Kontakte handelt.
Die Untersagung durch die Datenschutzbehörde
Die zuständige Datenschutzbehörde des Saarlandes sah in dieser Praxis einen Verstoß gegen das Datenschutzrecht. Mit Bescheid vom 10. Januar 2017 – damals noch auf Grundlage des alten Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG a.F.) – untersagte sie der Klägerin die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten von Zahnarztinhabern zum Zweck der Telefonwerbung, sofern keine Einwilligung des Betroffenen vorlag oder bereits ein Geschäftsverhältnis bestand. Zudem wurde die Löschung der bereits gesammelten Daten angeordnet und für den Fall der Nichtbefolgung ein Zwangsgeld angedroht.
Die Klägerin wehrte sich gegen diesen Bescheid, unterlag jedoch sowohl vor dem Verwaltungsgericht als auch mit ihrem Antrag auf Zulassung der Berufung vor dem Oberverwaltungsgericht. Der Bescheid wurde damit unanfechtbar, also rechtskräftig.
Der neue Anlauf: Hoffnung durch die DSGVO?
Nachdem die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) am 25. Mai 2018 in Kraft trat, sah die Klägerin eine neue Chance. Sie beantragte bei der Datenschutzbehörde die Aufhebung des alten Bescheids. Ihre Argumentation: Nach der neuen Rechtslage der DSGVO sei ihr Vorgehen nun rechtmäßig. Insbesondere berief sie sich auf Art. 6 Abs. 1 Unterabs. 1 Buchst. f DSGVO, der die Datenverarbeitung erlaubt, wenn sie zur Wahrung der berechtigten Interessen des Verantwortlichen erforderlich ist und die Interessen der betroffenen Person nicht überwiegen.
Die Datenschutzbehörde wies diesen Antrag jedoch zurück. Sie argumentierte, die Rechtslage habe sich nicht zugunsten der Klägerin geändert. Zwar sei nun Art. 6 Abs. 1 Unterabs. 1 Buchst. f DSGVO die relevante Norm, doch bei der notwendigen Interessenabwägung müsse die Regelung des § 7 Abs. 2 Nr. 2 des Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG) berücksichtigt werden. Diese Vorschrift verbietet Telefonwerbung gegenüber sonstigen Marktteilnehmern (also auch Unternehmen) ohne deren zumindest mutmaßliche Einwilligung. Da eine solche mutmaßliche Einwilligung der Zahnärzte nicht vorliege, sei die Datenverarbeitung mangels berechtigten Interesses unzulässig.
Die Vorinstanzen im erneuten Verfahren
Die Klägerin zog erneut vor Gericht. Das Verwaltungsgericht Saarlouis wies die Klage ab. Das Oberverwaltungsgericht (OVG) des Saarlandes wies die Berufung zurück. Das OVG argumentierte, dass die Voraussetzungen für ein Wiederaufgreifen des alten Verfahrens nicht gegeben seien, da sich die Rechtslage durch die DSGVO nicht zugunsten der Klägerin geändert habe.
Das OVG führte aus, dass die Zulässigkeit der Datenverarbeitung nach Art. 6 Abs. 1 Unterabs. 1 Buchst. f DSGVO eine umfassende Interessenabwägung erfordere. Diese Abwägung falle negativ für die Klägerin aus, weil ihre Telefonwerbung nicht den Anforderungen des § 7 Abs. 2 Nr. 1 UWG entspreche. Diese wettbewerbsrechtliche Norm sei im datenschutzrechtlichen Kontext zu berücksichtigen. Es fehle an einer mutmaßlichen Einwilligung der Zahnärzte, da der Verkauf von Edelmetallresten weder typisch noch wesentlich für deren Tätigkeit sei und die Veröffentlichung von Telefonnummern primär der Erreichbarkeit für Patienten diene.
Gegen dieses Urteil des OVG legte die Klägerin Revision beim Bundesverwaltungsgericht ein.
Die Kernfragen vor dem Bundesverwaltungsgericht
Das Bundesverwaltungsgericht musste sich im Wesentlichen mit zwei zentralen juristischen Fragenkomplexen auseinandersetzen:
- Verfahrensrechtliche Frage: Unter welchen Voraussetzungen kann ein bereits bestandskräftiger Verwaltungsakt aufgrund einer nachträglichen Änderung der Rechtslage (hier: Inkrafttreten der DSGVO) wiederaufgegriffen und möglicherweise aufgehoben werden? Konkret ging es um die Auslegung des § 51 Abs. 1 Nr. 1 Alt. 2 Saarländisches Verwaltungsverfahrensgesetz (SVwVfG), der dem § 51 VwVfG des Bundes entspricht.
- Materiell-rechtliche Hauptfrage: Wie ist das Verhältnis von Art. 6 Abs. 1 Unterabs. 1 Buchst. f DSGVO (berechtigtes Interesse) zu den nationalen Regelungen des § 7 UWG (unzumutbare Belästigungen durch Werbung) bei Telefonwerbung gegenüber Unternehmen zu bewerten? Darf ein Unternehmen Kontaktdaten aus öffentlichen Verzeichnissen für Telefonwerbung nutzen, wenn es sich auf ein „berechtigtes Interesse“ beruft, die Angerufenen aber nicht eingewilligt haben?
Die Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts: Kein Freibrief für Kaltakquise
Das Bundesverwaltungsgericht wies die Revision der Klägerin zurück (BVerwG, Urteil. vom 29.01.2025 – 6 C 3.23). Damit bleibt die Untersagungsverfügung der Datenschutzbehörde bestehen. Die Klägerin darf also weiterhin keine Zahnärzte ohne deren Einwilligung zu Werbezwecken anrufen.
Die Leitsätze des Urteils fassen die Kernaussagen prägnant zusammen:
- „Im Rahmen der Entscheidung über die Begründetheit eines Antrags auf Wiederaufgreifen des Verfahrens nach § 51 Abs. 1 Nr. 1 Alt. 2 SVwVfG hat das Gericht grundsätzlich abschließend zu prüfen, ob an dem unanfechtbaren Verwaltungsakt auf der Grundlage der neuen Rechtslage festzuhalten ist.“
- „Bei der Beurteilung, ob die Verarbeitung personenbezogener Daten zum Zweck der Telefonwerbung zur Wahrung eines ‚berechtigten Interesses‘ im Sinne des Art. 6 Abs. 1 Unterabs. 1 Buchst. f DSGVO erfolgt, sind die Wertungen des § 7 Abs. 2 Nr. 1 UWG, der die Vorgaben des Art. 13 der Richtlinie 2002/58/EG umsetzt, zu berücksichtigen.“
Diese Leitsätze sind wegweisend und haben erhebliche praktische Konsequenzen.
Die zentralen Entscheidungsgründe – verständlich erklärt
Das Gericht hat seine Entscheidung ausführlich begründet. Hier die wichtigsten Punkte verständlich aufbereitet:
1. Wiederaufgreifen des Verfahrens: DSGVO als Rechtsänderung, aber ohne Vorteil für die Klägerin
Das Gericht stellte zunächst klar, dass der Antrag der Klägerin auf Wiederaufgreifen des Verfahrens nach § 51 SVwVfG zulässig war. Das Inkrafttreten der DSGVO stellte tatsächlich eine nachträgliche Änderung der Rechtslage dar.
Allerdings, und das ist der entscheidende Punkt, war der Antrag nicht begründet. Eine Rechtsänderung führt nur dann zu einem erfolgreichen Wiederaufgreifen, wenn sie sich zugunsten des Betroffenen auswirkt. Das Gericht musste also prüfen, ob die Klägerin nach neuem Recht (DSGVO) besser dastünde als nach altem Recht (BDSG a.F.). Dies verneinte das BVerwG. Die Untersagung wäre auch unter Geltung der DSGVO rechtmäßig.
Interessanterweise stellte das Gericht hierzu fest (Leitsatz 1), dass bei einem Antrag auf Wiederaufgreifen wegen geänderter Rechtslage das Gericht vollumfänglich prüfen muss, ob die ursprüngliche Entscheidung auch unter dem neuen Recht Bestand hätte. Es reicht also nicht, dass die neue Rechtslage möglicherweise günstiger sein könnte.
2. Datenschutzrechtliche Bewertung: Art. 6 Abs. 1 Unterabs. 1 Buchst. f DSGVO als maßgebliche Norm
Da die Zahnärzte nicht in die Telefonanrufe eingewilligt hatten (Art. 6 Abs. 1 Unterabs. 1 Buchst. a DSGVO), kam als einzige Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung durch die Klägerin Art. 6 Abs. 1 Unterabs. 1 Buchst. f DSGVO in Betracht. Diese Vorschrift erlaubt die Verarbeitung personenbezogener Daten, wenn sie zur Wahrung der berechtigten Interessen des Verantwortlichen (hier der Klägerin) oder eines Dritten erforderlich ist, sofern nicht die Interessen oder Grundrechte und Grundfreiheiten der betroffenen Person (hier der Zahnärzte), die den Schutz personenbezogener Daten erfordern, überwiegen.
Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat hierfür ein dreistufiges Prüfschema entwickelt:
- Liegt ein berechtigtes Interesse des Verantwortlichen oder eines Dritten vor?
- Ist die Datenverarbeitung zur Verwirklichung dieses Interesses erforderlich?
- Überwiegen im Rahmen einer Abwägung die Interessen des Verantwortlichen die Interessen der betroffenen Person?
3. Der Knackpunkt: „Berechtigtes Interesse“ und die Verbindung zum Wettbewerbsrecht (§ 7 UWG)
Hier kommt Leitsatz 2 ins Spiel und damit die zentrale Aussage des Urteils: Bei der Prüfung des „berechtigten Interesses“ nach Art. 6 Abs. 1 Unterabs. 1 Buchst. f DSGVO müssen die Wertungen des § 7 Abs. 2 Nr. 1 UWG berücksichtigt werden.
Das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG) regelt in § 7, wann Werbung eine unzumutbare Belästigung darstellt. Speziell für Telefonwerbung gilt nach § 7 Abs. 2 Nr. 1 UWG: Eine unzumutbare Belästigung ist stets anzunehmen
- bei Werbung mit einem Telefonanruf gegenüber einem Verbraucher ohne dessen vorherige ausdrückliche Einwilligung oder
- gegenüber einem sonstigen Marktteilnehmer (z.B. einem anderen Unternehmen wie einer Zahnarztpraxis) ohne dessen zumindest mutmaßliche Einwilligung.
Das BVerwG argumentiert, dass das Datenschutzrecht (DSGVO) und das Wettbewerbsrecht (UWG) hier eng miteinander verknüpft sind. Das UWG setzt europäische Vorgaben um (insbesondere die ePrivacy-Richtlinie 2002/58/EG, Art. 13), die spezifische Regeln für elektronische Kommunikation, einschließlich Telefonwerbung, festlegt. Art. 95 DSGVO stellt klar, dass die DSGVO keine zusätzlichen Pflichten auferlegt, soweit spezifische Pflichten aus der ePrivacy-Richtlinie dasselbe Ziel verfolgen. Das BVerwG sieht hier aber keinen Widerspruch, der die DSGVO verdrängt, sondern eine notwendige gemeinsame Betrachtung.
Die Logik des Gerichts ist dabei stringent: Ein Interesse kann nicht „berechtigt“ im Sinne der DSGVO sein, wenn die damit verbundene Handlung (hier die Telefonwerbung) bereits nach anderen spezialgesetzlichen Vorschriften (hier § 7 UWG) unzulässig ist. Wer also gegen das Wettbewerbsrecht verstößt, kann sich in der Regel nicht auf ein berechtigtes Interesse für die dafür notwendige Datenverarbeitung berufen.
4. Keine mutmaßliche Einwilligung der Zahnärzte
Das Gericht prüfte sodann, ob im Fall der Klägerin eine mutmaßliche Einwilligung der Zahnärzte im Sinne des § 7 Abs. 2 Nr. 1 UWG vorlag. Eine solche Einwilligung kann angenommen werden, wenn aufgrund konkreter Umstände ein sachliches Interesse des Angerufenen an der Telefonwerbung vermutet werden kann. Der Werbende muss bei verständiger Würdigung annehmen dürfen, der Angerufene erwarte einen solchen Anruf oder werde ihm zumindest positiv gegenüberstehen.
Das BVerwG folgte hier der Einschätzung der Vorinstanzen:
- Die Veröffentlichung von Telefonnummern in Branchenverzeichnissen dient bei Zahnärzten primär der Erreichbarkeit für Patienten, nicht dem Empfang von Werbeanrufen über den Verkauf von Edelmetallresten.
- Der Verkauf von Edelmetallresten zur Gewinnerzielung ist weder eine typische noch eine wesentliche Tätigkeit eines Zahnarztes. Zahnärzte sind primär Heilberufler.
- Edelmetallreste werden zudem üblicherweise den Patienten als Eigentümern übergeben.
Somit lag keine mutmaßliche Einwilligung der Zahnärzte vor. Die Telefonanrufe der Klägerin stellten daher eine unzumutbare Belästigung nach § 7 UWG dar.
5. Folge: kein berechtigtes Interesse, keine rechtmäßige Datenverarbeitung
Da die Telefonwerbung wettbewerbswidrig war, konnte sich die Klägerin auch nicht auf ein berechtigtes Interesse nach Art. 6 Abs. 1 Unterabs. 1 Buchst. f DSGVO stützen. Ihre Datenverarbeitung (Erhebung, Speicherung und Nutzung der Kontaktdaten für die Anrufe) war somit rechtswidrig.
6. Kein Ermessensfehler der Behörde
Schließlich bestätigte das Gericht, dass die Datenschutzbehörde auch nach neuem Recht verpflichtet gewesen wäre, die rechtswidrige Datenverarbeitung zu untersagen (gemäß Art. 58 Abs. 2 Buchst. f DSGVO). Ihr Ermessen sei in einem solchen Fall auf null reduziert, d.h., sie musste einschreiten.
Einordnung und Hintergrund: Das Spannungsfeld Datenschutz und Direktmarketing
Dieses Urteil fügt sich ein in eine Reihe von Entscheidungen, die die Grenzen für Direktmarketing, insbesondere Telefonwerbung, immer klarer ziehen.
Die Rechtslage vor und nach dem Urteil
Vorher: Es gab durchaus Diskussionen, inwieweit Art. 6 Abs. 1 Unterabs. 1 Buchst. f DSGVO (berechtigtes Interesse) möglicherweise eine Art „Einfallstor“ für Werbemaßnahmen sein könnte, auch wenn diese nach nationalem Wettbewerbsrecht (UWG) kritisch zu sehen waren. Manche Akteure hofften, die DSGVO würde hier großzügigere Maßstäbe setzen, insbesondere im B2B-Bereich (Business-to-Business). Die Argumentation lautete oft, dass Unternehmen weniger schutzbedürftig seien als Verbraucher.
Nachher (bzw. durch das Urteil bestätigt und konkretisiert): Das BVerwG stellt klar, dass die DSGVO keinen Freibrief für wettbewerbswidrige Werbemethoden darstellt. Die Wertungen des UWG, das die spezifischen europäischen Regeln der ePrivacy-Richtlinie für unerwünschte Kommunikation umsetzt, sind integraler Bestandteil der Interessenabwägung unter der DSGVO. Wenn eine Werbeform nach UWG unzulässig ist (z.B. Telefonwerbung ohne erforderliche Einwilligung), dann kann das Interesse an dieser Werbung in der Regel nicht „berechtigt“ im Sinne der DSGVO sein.
Das zugrundeliegende Rechtsgebiet: DSGVO und UWG im Einklang
- Die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) ist eine EU-Verordnung, die seit Mai 2018 europaweit einheitlich den Schutz personenbezogener Daten regelt. Jede Verarbeitung personenbezogener Daten (wie Name, Adresse, Telefonnummer) benötigt eine Rechtsgrundlage. Art. 6 DSGVO listet diese auf (z.B. Einwilligung, Vertragserfüllung, berechtigtes Interesse).
- Das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG) schützt Mitbewerber, Verbraucher und sonstige Marktteilnehmer vor unlauteren geschäftlichen Handlungen. § 7 UWG ist hier besonders relevant, da er aggressive oder belästigende Werbemethoden verbietet.
Das Urteil unterstreicht, dass diese beiden Regelwerke nicht isoliert voneinander betrachtet werden dürfen, sondern sich ergänzen, um einen umfassenden Schutz zu gewährleisten.
Relevante Rechtsgrundlagen im Überblick
Die zentralen Normen, die in diesem Fall eine Rolle spielten, sind:
- Art. 6 Abs. 1 Unterabs. 1 Buchst. f DSGVO: Erlaubt Datenverarbeitung zur Wahrung berechtigter Interessen, wenn die Interessen der Betroffenen nicht überwiegen.
- Art. 4 Nr. 1 und 2 DSGVO: Definitionen von „personenbezogenen Daten“ und „Verarbeitung“.
- § 7 Abs. 2 Nr. 1 UWG: Regelung zur Unzulässigkeit von Telefonwerbung ohne (zumindest mutmaßliche) Einwilligung.
- Richtlinie 2002/58/EG (ePrivacy-Richtlinie): EU-Richtlinie zum Schutz der Privatsphäre in der elektronischen Kommunikation, die u.a. die Grundlage für § 7 UWG bildet.
- § 51 VwVfG (bzw. SVwVfG): Regelungen zum Wiederaufgreifen eines abgeschlossenen Verwaltungsverfahrens.
Praktische Relevanz & Ausblick: Was bedeutet das für Sie?
Die Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts hat erhebliche praktische Auswirkungen für alle Unternehmen, die Telefonmarketing betreiben oder planen – insbesondere im B2B-Bereich.
Für werbende Unternehmen: Vorsicht bei Kaltakquise!
- Öffentlich zugängliche Daten sind kein Freifahrtschein: Nur weil eine Telefonnummer im Internet oder in einem Branchenbuch steht, bedeutet das nicht, dass Sie diese Nummer für Werbeanrufe ohne Weiteres nutzen dürfen.
- Das „berechtigte Interesse“ ist kein Allheilmittel: Die Berufung auf Art. 6 Abs. 1 Unterabs. 1 Buchst. f DSGVO als Rechtsgrundlage für Telefonwerbung ist nur dann möglich, wenn die Werbung selbst nicht gegen andere Gesetze, insbesondere das UWG, verstößt.
- „Mutmaßliche Einwilligung“ im B2B-Bereich streng auszulegen: Die Hürden für die Annahme einer mutmaßlichen Einwilligung sind hoch. Es muss ein konkretes, sachbezogenes Interesse des angerufenen Unternehmens an genau dieser Art von Werbung zu genau diesem Zeitpunkt bestehen. Allgemeine Branchenzugehörigkeit oder die Hoffnung, ein gutes Angebot zu haben, reichen nicht aus. Überlegen Sie genau: Würde dieses spezifische Unternehmen Ihren Anruf wirklich erwarten oder begrüßen?
- Dokumentation ist entscheidend: Wenn Sie sich auf eine (ausdrückliche oder mutmaßliche) Einwilligung stützen, müssen Sie diese im Zweifel nachweisen können.
- Risiko von Bußgeldern und Abmahnungen: Verstöße gegen die DSGVO können hohe Bußgelder nach sich ziehen. Wettbewerbswidrige Werbung kann zudem zu teuren Abmahnungen durch Konkurrenten oder Verbände führen.
Unternehmen sind gut beraten, ihre Akquisestrategien kritisch zu überprüfen. Im Zweifel ist es immer sicherer, eine ausdrückliche Einwilligung für Werbeanrufe einzuholen, beispielsweise über ein Double-Opt-In-Verfahren auf der Webseite oder im Rahmen bestehender Geschäftsbeziehungen für ähnliche Produkte/Dienstleistungen (unter Beachtung der engen Grenzen des § 7 Abs. 3 UWG für E-Mail-Werbung, die hier aber nicht direkt Thema war).
Für angerufene Unternehmen und Freiberufler: Stärkung Ihrer Rechte
Auch wenn Sie als Unternehmen oder Freiberufler agieren, müssen Sie nicht jeden Werbeanruf dulden. Das Urteil stärkt Ihre Position:
- Sie können sich gegen unerwünschte Telefonwerbung wehren, auch wenn der Anrufer ein anderes Unternehmen ist.
- Die Tatsache, dass Ihre Kontaktdaten öffentlich sind, gibt Anrufern nicht automatisch das Recht, Sie zu Werbezwecken zu kontaktieren.
- Wenn Sie sich belästigt fühlen, können Sie dies dem Anrufer mitteilen und ihn auffordern, weitere Anrufe zu unterlassen. Bei fortgesetzten Verstößen können Sie sich an die zuständige Datenschutzbehörde oder an Wettbewerbsverbände wenden.
Das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts ist ein wichtiges Signal für einen faireren Wettbewerb und einen besseren Schutz vor unerwünschter Werbung, auch im geschäftlichen Verkehr. Es betont die Notwendigkeit einer sorgfältigen Abwägung zwischen den Marketinginteressen von Unternehmen und dem Recht der Angerufenen auf informationelle Selbstbestimmung und Schutz vor Belästigungen. Die Zeiten, in denen Telefonbücher als frei verfügbare Akquise-Listen für jedwede Art von Kaltanrufen angesehen wurden, sind damit endgültig vorbei.
Häufig gestellte Fragen zum Thema Kaltakquise und Telefonwerbung nach dem BVerwG-Urteil
Nachfolgend beantworten wir die häufigsten Fragen zu unserem Artikel über das BVerwG-Urteil zur Kaltakquise am Telefon und dessen Auswirkungen für Unternehmen.
Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Darf ich als Unternehmen jetzt überhaupt keine anderen Firmen mehr zu Werbezwecken anrufen, wenn ich deren Nummer z.B. aus einem Branchenbuch habe?
Was genau bedeutet „mutmaßliche Einwilligung“ im B2B-Bereich und wie kann ich als anrufendes Unternehmen sicher sein, dass diese vorliegt?
Die Klägerin berief sich auf ihr „berechtigtes Interesse“ nach der DSGVO. Warum hat ihr das vor Gericht nicht geholfen?
Welche Konsequenzen drohen mir als Unternehmer, wenn ich mich nicht an diese Regeln halte und trotzdem Kaltakquise bei anderen Firmen ohne deren Einwilligung betreibe?
Ich bin selbst Freiberufler. Gilt dieser Schutz vor unerwünschten Werbeanrufen auch für mich, oder nur für größere Unternehmen?