Eine Patientin beantragte im Rahmen eines Selbständigen Beweisverfahrens zur Arzthaftung die Überprüfung ihrer Unterlagen nach mehreren gescheiterten Operationen. Trotz umfangreicher Behandlungsunterlagen stoppte das OLG den Prozess: Die bloße Hoffnung auf einen Fehler genügte für den Beweisantrag nicht.
Übersicht
- 1 Das Wichtigste in Kürze
- 2 Selbständiges Beweisverfahren in der Arzthaftung: Warum reicht ein vager Verdacht nicht aus?
- 3 Was war der Auslöser des Rechtsstreits?
- 4 Welche Spielregeln gelten für das selbständige Beweisverfahren?
- 5 Warum scheiterte der Antrag der Patientin im Detail?
- 5.1 Der pauschale Vorwurf eines Fehlers genügt nicht
- 5.2 Ein schlechtes Ergebnis allein ist kein Beweis für einen Fehler
- 5.3 Der Verweis auf medizinische Unterlagen ersetzt keinen konkreten Vortrag
- 5.4 Das Verfahren ist kein „Fischzug“ nach Fehlern
- 5.5 Die pauschale Meinung anderer Ärzte muss präzisiert werden
- 6 Welche Lehren lassen sich aus diesem Urteil ziehen?
- 7 Die Urteilslogik
- 8 Benötigen Sie Hilfe?
- 9 Experten Kommentar
- 10 Häufig gestellte Fragen (FAQ)
- 10.1 Wie kann ich einen Behandlungsfehler klären, ohne sofort eine teure Klage einzureichen?
- 10.2 Reicht die Vorlage meiner Krankenakte aus, um einen Behandlungsfehler im Verfahren zu beweisen?
- 10.3 Wie muss ich den Verdacht auf einen Behandlungsfehler im Beweisantrag konkret benennen?
- 10.4 Was tun, wenn das Gericht meinen Beweisantrag wegen eines zu vagen Verdachts ablehnt?
- 10.5 Wie bereite ich medizinische Unterlagen vor, um das Risiko eines unzulässigen ‚Fischzugs‘ zu vermeiden?
- 11 Glossar – Fachbegriffe kurz erklärt
- 12 Das vorliegende Urteil
Zum vorliegenden Urteil Az.: 8 W 21/24 | Schlüsselerkenntnis | FAQ | Glossar | Kontakt
Das Wichtigste in Kürze
- Gericht: Oberlandesgericht Düsseldorf
- Datum: 27.03.2025
- Aktenzeichen: 8 W 21/24
- Verfahren: Beschwerdeverfahren
- Rechtsbereiche: Arzthaftungsrecht, Zivilprozessrecht
- Das Problem: Eine Patientin wollte in einem Arzthaftungsprozess durch einen Sachverständigen prüfen lassen, ob ihre Operation fehlerhaft war. Das Gericht lehnte den Antrag ab, weil er zu unpräzise war.
- Die Rechtsfrage: Reicht es aus, in einem Prozess nur pauschal das Vorliegen eines Behandlungsfehlers zu behaupten und alle Behandlungsunterlagen vorzulegen?
- Die Antwort: Nein. Der Antragsteller muss konkrete Tatsachen oder Anhaltspunkte nennen, die den Fehler plausibel machen. Das Gericht ist nicht verpflichtet, die Akten selbst nach Hinweisen zu durchsuchen.
- Die Bedeutung: Wer Ärzte wegen eines Behandlungsfehlers verklagen will, muss den mutmaßlichen Fehler präzise beschreiben. Reine Unzufriedenheit mit dem Ergebnis oder die Vorlage pauschaler Unterlagen reichen zur Einleitung eines Beweisverfahrens nicht aus.
Selbständiges Beweisverfahren in der Arzthaftung: Warum reicht ein vager Verdacht nicht aus?
Wenn eine medizinische Behandlung nicht den erhofften Erfolg bringt, steht oft ein schwerwiegender Verdacht im Raum: Wurde ein Fehler gemacht? Für Patienten ist dies eine quälende Frage, denn sie sind medizinische Laien. Wie sollen sie beweisen, was im Operationssaal oder während der Therapie schiefgelaufen ist? Ein gängiges juristisches Instrument, um vor einer Klage Klarheit zu schaffen, ist das selbständige Beweisverfahren. Es ermöglicht, durch einen gerichtlich bestellten Gutachter Fakten zu sichern. Doch welche Hürden muss ein Patient nehmen, um ein solches Verfahren überhaupt in Gang zu setzen? Ein Beschluss des Oberlandesgerichts Düsseldorf vom 27. März 2025 (Az. 8 W 21/24) zeichnet hier eine bemerkenswert klare Linie und verdeutlicht, warum die bloße Vorlage eines Aktenordners voller Behandlungsunterlagen nicht ausreicht.
Was war der Auslöser des Rechtsstreits?
Im Zentrum des Falles stand eine Patientin, die mit dem Ergebnis mehrerer Operationen unzufrieden war. Sie hegte den Verdacht, dass die behandelnden Ärzte Fehler gemacht hatten. Diesen Verdacht stützte sie auf zwei wesentliche Punkte: erstens auf das unbefriedigende Ergebnis selbst und zweitens auf Aussagen von Nachbehandlern, die die vorangegangene Behandlung als fehlerhaft bezeichnet haben sollen.
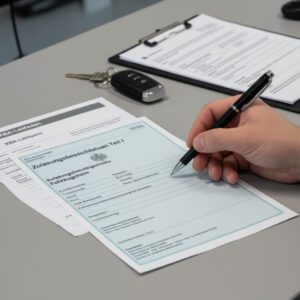
Um diesen Verdacht zu erhärten und eine Grundlage für eine mögliche Schadensersatzklage zu schaffen, beantragte sie beim Landgericht Krefeld die Einleitung eines selbständigen Beweisverfahrens. Dieses Verfahren dient dazu, den Zustand einer Sache oder die Ursache eines Schadens durch einen neutralen Sachverständigen feststellen zu lassen, bevor es zu einem langwierigen Hauptprozess kommt. Die Patientin legte ihrem Antrag ihre umfangreichen medizinischen Unterlagen bei und stellte die allgemeine Frage, ob ein Behandlungsfehler vorliege.
Die Gegenseite, die Ärzte beziehungsweise die Klinik, wehrte sich gegen diesen Antrag. Ihr zentrales Argument: Der Antrag sei unzulässig, weil er nicht konkret genug sei. Die Patientin stelle lediglich pauschal einen Fehler in den Raum, ohne auch nur einen einzigen konkreten Anhaltspunkt zu benennen, worin dieser Fehler bestehen solle. Das Landgericht Krefeld folgte dieser Argumentation und wies den Antrag als unzulässig zurück. Die Patientin legte daraufhin Sofortige Beschwerde beim Oberlandesgericht Düsseldorf ein.
Welche Spielregeln gelten für das selbständige Beweisverfahren?
Um die Entscheidung des Gerichts nachvollziehen zu können, muss man die Logik hinter dem selbständigen Beweisverfahren verstehen. Geregelt ist es in den §§ 485 ff. der Zivilprozessordnung (ZPO). Es ist gewissermaßen ein „vorgezogener“ Teil eines Gerichtsverfahrens, der darauf abzielt, Beweise schnell und objektiv zu sichern.
Das Herzstück der Anforderungen an einen solchen Antrag findet sich in § 487 ZPO. Diese Norm schreibt vor, was der Antragsteller dem Gericht mitteilen muss. Besonders entscheidend ist hier die Nummer 2: Der Antrag muss die Tatsachen bezeichnen, über die Beweis erhoben werden soll.
Was bedeutet das konkret? Es bedeutet, dass der Antragsteller nicht einfach nur eine Frage stellen darf („Liegt ein Fehler vor?“). Er muss dem Gericht vielmehr einen konkreten Sachverhalt schildern, der durch den Gutachter überprüft werden soll. Sie müssen also nicht den Fehler beweisen, aber Sie müssen die Tatsachen benennen, aus denen sich ein Fehler ergeben könnte. Diese benannten Tatsachen stecken den Rahmen ab, den der Gutachter untersuchen darf und dessen Ergebnisse später in einem möglichen Prozess verwertbar sind (§ 493 ZPO). Ohne diesen klaren Rahmen wüsste der Gutachter nicht, wo er anfangen soll, und die Gegenseite wüsste nicht, wogegen sie sich verteidigen muss.
Warum scheiterte der Antrag der Patientin im Detail?
Das Oberlandesgericht Düsseldorf bestätigte die Entscheidung des Landgerichts und wies die Beschwerde der Patientin zurück. Die Richter arbeiteten in ihrer Begründung präzise heraus, warum der Antrag die Hürde des § 487 Nr. 2 ZPO nicht überwinden konnte. Ihre Analyse lässt sich in mehreren Schritten nachvollziehen.
Der pauschale Vorwurf eines Fehlers genügt nicht
Das Gericht stellte klar, dass ein Antragsteller die Beweisthemen konkret benennen muss. Es reicht nicht aus, allgemein zu behaupten, die Operationen seien fehlerhaft gewesen. Stattdessen hätte die Patientin darlegen müssen, welche konkrete Handlung oder welche Unterlassung der Ärzte aus ihrer Sicht einen Verstoß gegen die medizinischen Sorgfaltspflichten darstellt. Ohne diese Konkretisierung bleibt der Vorwurf im Nebel und ist für eine juristische Überprüfung nicht greifbar.
Ein schlechtes Ergebnis allein ist kein Beweis für einen Fehler
Die Patientin selbst räumte ein, dass ein unbefriedigendes Operationsergebnis nicht automatisch auf einen Behandlungsfehler schließen lässt. Jede medizinische Behandlung birgt Risiken, die sich auch bei sorgfältigstem Vorgehen verwirklichen können. Das Gericht griff diesen Punkt auf und betonte, dass eben aus diesem Grund mehr vorgetragen werden müsse als nur die Unzufriedenheit mit dem Resultat. Es bedarf zusätzlicher Anhaltspunkte, die einen konkreten Verdacht auf ein fehlerhaftes Vorgehen plausibel machen.
Der Verweis auf medizinische Unterlagen ersetzt keinen konkreten Vortrag
Dies ist der vielleicht wichtigste Punkt der Entscheidung. Die Patientin hatte dem Gericht ihre vollständigen Behandlungsunterlagen vorgelegt, in der Annahme, der Sachverständige – oder das Gericht selbst – würde darin schon die relevanten Hinweise auf Fehler finden. Dieser Vorgehensweise erteilte das OLG eine klare Absage. Es stützte sich dabei auf die ständige Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs (u.a. BGH, Beschluss vom 10.11.2015, VI ZB 11/15).
Die Richter erklärten, dass Anlagen wie Behandlungsdokumente zwar zur Erläuterung oder zum Beweis eines schriftlichen Vortrags dienen können, diesen aber niemals ersetzen. Das Gericht ist nicht verpflichtet, hunderte Seiten medizinischer Dokumentation eigenständig zu durchsuchen, um die Argumente des Antragstellers zu finden. Die Aufgabe des Antragstellers ist es, die relevanten Stellen zu identifizieren und dem Gericht zu erklären, warum genau diese Seite oder jener Laborwert ein Indiz für einen Behandlungsfehler ist.
Das Verfahren ist kein „Fischzug“ nach Fehlern
Die Richter machten deutlich, dass das selbständige Beweisverfahren kein Instrument für einen „Fischzug im Trüben“ ist. Würde man einem Gutachter den pauschalen Auftrag erteilen, eine komplette Behandlungshistorie nach „irgendwelchen“ Fehlern zu durchsuchen, käme dies einer unzulässigen Ausforschung gleich. Der Gutachter hätte keinen klaren Auftrag und müsste quasi detektivisch auf Fehlersuche gehen. Das ist aber nicht die Aufgabe eines gerichtlich bestellten Sachverständigen. Seine Aufgabe ist es, klar definierte Tatsachenfragen zu beantworten.
Die pauschale Meinung anderer Ärzte muss präzisiert werden
Auch das Argument, Nachbehandler hätten die Behandlung als fehlerhaft eingestuft, ließ das Gericht nicht gelten. Eine solche Behauptung bleibt substanzlos, solange nicht dargelegt wird, worin dieser Fehler nach Meinung der anderen Ärzte konkret bestanden haben soll. Ohne diese Präzisierung ist der Verweis nicht mehr als ein Gerücht und kann die notwendige Konkretisierung der Beweistatsachen nicht leisten.
Welche Lehren lassen sich aus diesem Urteil ziehen?
Dieser Beschluss des Oberlandesgerichts Düsseldorf ist mehr als eine Einzelfallentscheidung. Er beleuchtet ein fundamentales Prinzip des Zivilprozesses, das gerade in der komplexen Materie der Arzthaftung von enormer praktischer Bedeutung ist.
Die zentrale Erkenntnis lautet: Das selbständige Beweisverfahren ist ein scharfes Schwert, aber kein Spürhund. Es dient der gezielten Untersuchung eines bereits konkretisierten Verdachts, nicht der Suche nach einem solchen Verdacht. Die Last, diesen Verdacht greifbar zu machen, liegt allein beim Antragsteller. Er muss dem Gericht und dem Gutachter den Weg weisen, indem er präzise Tatsachen benennt, die überprüft werden sollen. Die Vorstellung, man könne dem Gericht einen Stapel Unterlagen übergeben und auf das Beste hoffen, ist ein prozessualer Trugschluss.
Für Patienten und ihre anwaltliche Vertretung bedeutet dies, dass vor der Einleitung eines solchen Verfahrens intensive Vorarbeit geleistet werden muss. Medizinische Unterlagen müssen nicht nur gesammelt, sondern sorgfältig analysiert werden, idealerweise mit Unterstützung eines medizinischen Fachmanns. Das Ziel muss sein, aus dem Gefühl, dass „etwas nicht stimmt“, eine greifbare Hypothese zu formen: eine konkrete Handlung, eine verdächtige Dokumentation, eine unterlassene Maßnahme. Erst wenn ein solcher konkreter Anhaltspunkt existiert, kann das selbständige Beweisverfahren seine Stärke als effektives Instrument zur Beweissicherung voll entfalten.
Die Urteilslogik
Das selbständige Beweisverfahren zwingt den Antragsteller, seinen Verdacht von Behandlungsfehlern aus der vagen Behauptung in eine überprüfbare, konkrete Tatsachenbehauptung zu überführen.
- Konkretisiere den Vorwurf: Wer ein selbständiges Beweisverfahren einleitet, muss die tatsächlichen Umstände präzise benennen, die einen Verstoß gegen die ärztliche Sorgfaltspflicht darstellen könnten, da ein unbefriedigendes Behandlungsergebnis allein keinen Fehler indiziert.
- Die Dokumente ersetzen nicht den Vortrag: Die Vorlage umfassender Behandlungsunterlagen entbindet den Antragsteller nicht von der Pflicht, die relevanten Passagen und Indizien selbst zu identifizieren und den konkreten Sachverhalt, der geprüft werden soll, darzulegen.
- Verhindere den Ausforschungsantrag: Das selbständige Beweisverfahren dient der gezielten Sicherung bereits existierender Beweise, es darf nicht als Instrument für einen „Fischzug“ missbraucht werden, um pauschal nach Fehlern in einer vollständigen Behandlungshistorie zu suchen.
Jeder, der juristische Klarheit sucht, muss die Last tragen, das Beweisthema präzise einzugrenzen und dem Gutachter einen eindeutigen Weg zur Überprüfung zu weisen.
Benötigen Sie Hilfe?
Fehlen Ihnen konkrete Anhaltspunkte zur Präzisierung Ihres vermuteten Behandlungsfehlers? Erhalten Sie eine professionelle Einschätzung Ihres Falls.
Experten Kommentar
Juristisch gesehen ist ein dick gefüllter Aktenordner voller Behandlungsunterlagen erst einmal nur Papier, solange niemand die relevanten Passagen konkret benennt. Das OLG Düsseldorf zieht hier eine klare rote Linie: Das selbständige Beweisverfahren ist kein Freifahrtschein für einen „Fischzug im Trüben“, bei dem der Sachverständige auf gut Glück Fehler sucht. Wer einen vermeintlichen Behandlungsfehler überprüfen lassen will, muss den Verdacht bereits so weit konkretisieren, dass der Gutachter eine spezifische Handlung oder Unterlassung prüfen kann. Dieses Urteil unterstreicht, dass vor dem Antrag intensive Vorarbeit und eine tiefe Analyse der medizinischen Dokumente unverzichtbar sind, um überhaupt die Zulässigkeitshürde zu nehmen.
Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Wie kann ich einen Behandlungsfehler klären, ohne sofort eine teure Klage einzureichen?
Um die Faktenlage objektiv zu klären und hohe Kosten zu vermeiden, nutzen Sie das selbständige Beweisverfahren. Dieses juristische Instrument (§§ 485 ff. ZPO) ermöglicht es, vor einem Hauptprozess Beweise zu sichern. Ein gerichtlich bestellter, neutraler Sachverständiger prüft gezielt Ihren Verdacht. Gelingt die Beweisführung, stärkt dies Ihre Verhandlungsposition massiv, falls Sie sich später für eine Klage entscheiden.
Das Verfahren dient in erster Linie der Beweissicherung. Es klärt spezifische medizinische Tatsachenfragen, etwa ob eine notwendige Kontrolluntersuchung unterlassen wurde oder bestimmte Standards eingehalten wurden. Da hierbei kein umfassender Schadensersatzanspruch verhandelt wird, fallen die Verfahrenskosten und der Zeitaufwand zunächst geringer aus. Sie schaffen damit eine objektive, gerichtliche Grundlage für die Beurteilung Ihres Verdachts.
Obwohl dieses Vorgehen schneller und günstiger ist als eine mehrjährige Hauptklage, stellt es hohe Anforderungen an die Präzision Ihres Antrags. Sie dürfen nicht allgemein nach „irgendwelchen Fehlern“ suchen, da das Verfahren kein Freibrief für eine Ausforschung ist. Gemäß § 487 Nr. 2 ZPO müssen Sie die konkreten Tatsachen bezeichnen, über die Beweis erhoben werden soll, nicht nur das unbefriedigende Behandlungsergebnis.
Um eine Ablehnung zu vermeiden, wandeln Sie Ihren Verdacht mithilfe eines Anwalts sofort in eine greifbare Hypothese um, die klare Handlungen oder Unterlassungen benennt.
Reicht die Vorlage meiner Krankenakte aus, um einen Behandlungsfehler im Verfahren zu beweisen?
Nein, die bloße Vorlage der vollständigen Krankenakte genügt im gerichtlichen Verfahren nicht. Behandlungsdokumente sind zwar wichtige Beweismittel, sie ersetzen jedoch niemals den notwendigen, schriftlichen Sachvortrag des Klägers. Das Oberlandesgericht Düsseldorf stellte klar, dass Richter nicht verpflichtet sind, Hunderte Seiten selbstständig nach Fehlern zu durchsuchen, eine Haltung, die der ständigen BGH-Rechtsprechung entspricht.
Der Hintergrund dieser Anforderung ist die Pflicht zur Substantiierung. Die umfangreichen Anlagen dienen dem Gericht lediglich zur Erläuterung und Untermauerung Ihrer Behauptungen, nicht zur eigenständigen Faktensuche. Richter handeln nicht als medizinische Detektive, um in Ihrem Aktenstapel die relevanten Indizien zu identifizieren. Sie müssen dem Gericht präzise mitteilen, welche konkreten Tatsachen – etwa ein verzögertes Laborergebnis oder eine fehlende Unterschrift – einen Fehler im ärztlichen Vorgehen vermuten lassen. Ohne diese gezielte Benennung wird der Antrag als unzulässiger „Fischzug im Trüben“ abgewiesen.
Konkret: Die Patientin aus dem OLG-Fall hatte dem Gericht ihre gesamten Unterlagen vorgelegt, in der Annahme, der Sachverständige würde darin schon die relevanten Fehler finden. Das OLG lehnte diese Vorgehensweise ab, da die Gerichte keinen allgemeinen Ermittlungsauftrag haben. Ihr Antrag muss dem Gutachter und dem Gericht einen klaren Fahrplan geben. Dies geschieht, indem Sie präzise Seitenzahlen und Passagen nennen, die in direktem Zusammenhang mit dem vermuteten Fehler stehen und so den Prüfrahmen abstecken.
Kopieren Sie die relevanten drei bis fünf Seiten der Akte, die den Verdacht stützen, und erstellen Sie hierzu einen Kommentar, welche medizinische Pflichtverletzung Sie vermuten.
Wie muss ich den Verdacht auf einen Behandlungsfehler im Beweisantrag konkret benennen?
Im selbständigen Beweisverfahren genügt es nicht, lediglich den allgemeinen Verdacht auf einen Behandlungsfehler zu äußern. Juristisch müssen Sie die Tatsachen bezeichnen, über die Beweis erhoben werden soll (§ 487 Nr. 2 ZPO). Das bedeutet, Sie müssen die konkrete ärztliche Handlung oder Unterlassung klar definieren, die Sie für fehlerhaft halten. Konkret formulieren Sie etwa: „Unterlassung der notwendigen Kontrolluntersuchung am 10.05.2024“, statt nur das schlechte Ergebnis zu benennen.
Präzision ist notwendig, weil ein unbefriedigendes Operationsergebnis allein niemals einen Behandlungsfehler beweist. Misserfolge können auch bei optimaler Durchführung und größter Sorgfalt eintreten. Ein Antrag darf daher nicht allgemein fragen, ob ein Fehler vorliegt. Stattdessen müssen Sie dem Gericht die spezifische Hypothese vorlegen: Ist es fachmedizinisch fehlerhaft, dass Maßnahme A unterlassen wurde, obwohl Indikation B vorlag? Die Benennung dieser konkreten Pflichtverletzung grenzt das Beweisthema klar und zulässig ein.
Ihre genaue Formulierung des Beweisantrags schafft den Untersuchungsrahmen für den Sachverständigen. Nur die von Ihnen benannten Beweistatsachen darf der gerichtlich bestellte Gutachter untersuchen. Vermeiden Sie pauschale Vorwürfe wie „Die gesamte Behandlung war fehlerhaft“, da dies der Logik einer Ausforschung gleichkäme. Erstellen Sie eine Liste, die links die vermutete Pflichtverletzung und rechts die dazu passende, präzise Beweisfrage für den Gutachter gegenüberstellt.
Wandeln Sie Ihren vagen Verdacht in eine präzise Hypothese um, indem Sie jede vermutete Pflichtverletzung einer konkreten Tatsache zur Überprüfung gegenüberstellen.
Was tun, wenn das Gericht meinen Beweisantrag wegen eines zu vagen Verdachts ablehnt?
Die Ablehnung Ihres Antrags auf ein selbständiges Beweisverfahren ist ein klares Signal, dass die richterlichen Anforderungen an die Konkretisierung nicht erfüllt wurden. Sie müssen schnell handeln, um Ihren Fall nicht zu gefährden. Das juristisch korrekte Mittel gegen den ablehnenden Beschluss des Landgerichts ist die sofortige Beschwerde.
Diese Beschwerde muss innerhalb einer kurzen Frist eingereicht werden, ist aber nur dann aussichtsreich, wenn Sie die ursprünglich bemängelten Mängel beheben. Das Oberlandesgericht Düsseldorf stellte in einem ähnlichen Fall klar, dass eine rein formelle oder emotionale Beschwerde scheitern muss. Die Richter des OLG betonten, dass die Ablehnung signalisiert, Ihr Antrag habe den hohen Anforderungen des § 487 Nr. 2 ZPO nicht genügt. Sie haben zu pauschal argumentiert und lediglich das schlechte Behandlungsergebnis, nicht aber konkrete Tatsachen, benannt.
Der Ablehnungsbeschluss dient Ihnen als detaillierter Wegweiser, der präzise aufzeigt, welche Substanz fehlt. Konzentrieren Sie sich darauf, die im Beschluss bemängelten Punkte innerhalb der Beschwerdefrist präzise nachzuliefern. Nehmen wir an, das Gericht kritisierte das Fehlen von Zeitangaben: Sie müssen in der Beschwerde genau darlegen, welche konkrete Handlung (etwa die Unterlassung einer notwendigen Kontrolle) zu welchem Zeitpunkt und an welchem Ort stattgefunden haben soll. Das Gericht handelt nicht als Detektiv und ist nicht verpflichtet, die relevanten Fehler in unstrukturierten Akten zu suchen.
Lassen Sie Ihren Anwalt den Beschluss sofort analysieren, um die fehlenden, konkreten Beweisthemen innerhalb der kurzen Frist rechtssicher nachzuliefern.
Wie bereite ich medizinische Unterlagen vor, um das Risiko eines unzulässigen ‚Fischzugs‘ zu vermeiden?
Um einen unzulässigen Fischzug zu vermeiden, ist intensive Vorarbeit unerlässlich. Es genügt nicht, dem Gericht einfach einen Aktenordner vorzulegen. Sie müssen Ihre Unterlagen mit fachkundiger Hilfe analysieren, um Ihren vagen Verdacht in eine greifbare, überprüfbare Hypothese umzuwandeln. Das selbständige Beweisverfahren dient der gezielten Untersuchung eines bereits konkretisierten Verdachts, nicht der pauschalen Suche nach einem solchen Verdacht.
Die Pflicht zur detaillierten Analyse liegt allein beim Antragsteller, denn Richter sind nicht dazu verpflichtet, hunderte Seiten selbstständig nach möglichen Behandlungsfehlern zu durchsuchen. Identifizieren Sie verdächtige Dokumentationspunkte – etwa fehlende Einträge, abweichende Laborbefunde oder zeitliche Verzögerungen – und markieren Sie diese präzise. Holen Sie idealerweise vorab eine medizinische Vorprüfung ein, um die Hypothese fachlich zu untermauern und Ihren Verdacht plausibel zu machen.
Erstellen Sie für das Verfahren einen klaren juristischen Fahrplan. Dies bedeutet, dass Sie dem Gericht und dem Gutachter einen Wegweiser liefern müssen. Nennen Sie präzise Seitenzahlen und Passagen der Akte, die im direkten Zusammenhang mit dem vermuteten Mangel stehen. Konkret: Eine Analyse-Matrix kann helfen, die für jede vermutete Pflichtverletzung (zum Beispiel eine zu späte Diagnose) den relevanten Aktenverweis, den angenommenen Normverstoß und die daraus resultierende konkrete Beweisfrage klar benennt.
Nutzen Sie diese Analyse-Matrix, um sicherzustellen, dass Ihr Antrag die hohen Anforderungen an die notwendige Konkretisierung der Beweisthemen erfüllt.
Hinweis: Bitte beachten Sie, dass die Beantwortung der FAQ Fragen keine individuelle Rechtsberatung darstellt und ersetzen kann. Alle Angaben im gesamten Artikel sind ohne Gewähr. Haben Sie einen ähnlichen Fall und konkrete Fragen oder Anliegen? Zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren. Wir klären Ihre individuelle Situation und die aktuelle Rechtslage.
Glossar – Fachbegriffe kurz erklärt
Ausforschung (Juristischer Fischzug)
Ausforschung nennen Juristen den unzulässigen Versuch eines Klägers, dem Gericht oder dem Sachverständigen einen pauschalen Ermittlungsauftrag zu erteilen, um „irgendwelche“ Fehler in den Unterlagen zu finden.
Das Zivilprozessrecht verlangt, dass jede Partei weiß, wogegen sie sich verteidigen muss, weshalb Verfahren keine allgemeine, detektivische Fehlersuche auf Kosten des Gegners erlauben.
Beispiel: Das Oberlandesgericht Düsseldorf wies den Antrag der Patientin zurück, weil es bei der pauschalen Fragestellung an den Sachverständigen klarstellte, dass das selbständige Beweisverfahren kein Freibrief für einen Fischzug im Trüben ist.
Beweissicherung
Beweissicherung ist das prozessuale Ziel, bestimmte Tatsachen oder Zustände durch gerichtliche Feststellung zu konservieren, solange die Beweismittel noch zugänglich sind oder bevor sie sich verändern.
Das Gesetz schützt auf diese Weise die Rechte des Antragstellers, indem es verhindert, dass wichtige Fakten verloren gehen, bevor ein langwieriger Hauptprozess beginnen kann.
Beispiel: Patienten nutzen die Beweissicherung im Arzthaftungsrecht, um den Zustand nach einer Operation oder die Ursache eines vermuteten Schadens durch einen neutralen Gutachter dokumentieren zu lassen.
Konkretisierung (der Tatsachen)
Die Konkretisierung der Tatsachen ist die zwingende Anforderung des § 487 ZPO, dass Antragsteller im Beweisverfahren präzise benennen müssen, welche konkreten Handlungen oder Unterlassungen ärztlicherseits überprüft werden sollen.
Diese Anforderung verhindert pauschale Anschuldigungen und steckt den Untersuchungsrahmen für den Sachverständigen klar ab, um die Verfahrensrechte der Gegenseite zu wahren.
Beispiel: Ohne die notwendige Konkretisierung konnte die Patientin dem Gericht nicht darlegen, welche spezifische Maßnahme einen Verstoß gegen die medizinischen Sorgfaltspflichten darstellte, weshalb der Beweisantrag scheiterte.
Schriftlicher Sachvortrag
Ein schriftlicher Sachvortrag meint die Pflicht der Prozessparteien, alle relevanten Argumente und Tatsachen, auf die sie ihre Klage oder ihren Antrag stützen, detailliert und in Textform gegenüber dem Gericht darzulegen.
Das Gericht braucht eine strukturierte, schriftliche Argumentation, da beigefügte Anlagen wie Krankenakten nur als Beweismittel dienen und den tatsächlichen, erklärenden Vortrag niemals ersetzen dürfen.
Beispiel: Die bloße Vorlage hunderter Seiten medizinischer Dokumente ohne einen erklärenden schriftlichen Sachvortrag genügte dem Oberlandesgericht Düsseldorf nicht, um den Verdacht auf einen Behandlungsfehler zu substantiieren.
Selbständiges Beweisverfahren
Das selbständige Beweisverfahren (§§ 485 ff. ZPO) ist ein gerichtliches Instrument, das es ermöglicht, Beweise durch einen Sachverständigen außerhalb eines laufenden Hauptprozesses zu sichern.
Dieses Verfahren schafft oft vor einer kostspieligen Hauptklage Klarheit über die Faktenlage und hilft den Parteien zu entscheiden, ob eine gerichtliche Geltendmachung von Schadensersatz überhaupt Aussicht auf Erfolg hat.
Beispiel: Im vorliegenden Fall beantragte die Patientin die Einleitung des selbständigen Beweisverfahrens, um herauszufinden, ob die unbefriedigenden Operationsergebnisse auf einem konkreten Behandlungsfehler beruhten.
Sofortige Beschwerde
Als sofortige Beschwerde wird das spezielle Rechtsmittel bezeichnet, mit dem ein Beschwerdeführer einen ablehnenden Beschluss eines erstinstanzlichen Gerichts (zum Beispiel des Landgerichts) durch das übergeordnete Gericht (zum Beispiel OLG) überprüfen lässt.
Dieses Rechtsmittel steht nur gegen bestimmte richterliche Entscheidungen zur Verfügung und muss meist innerhalb einer sehr kurzen Frist eingereicht werden, um eine schnelle Klärung formaler prozessualer Fragen zu gewährleisten.
Beispiel: Nachdem das Landgericht Krefeld den Beweisantrag als unzulässig zurückgewiesen hatte, legte die Patientin sofortige Beschwerde beim Oberlandesgericht Düsseldorf ein, um die Ablehnung anfechten zu lassen.
Das vorliegende Urteil
Verwaltungsgericht Gelsenkirchen – Az.: 14 K 120/24 – Urteil vom 20.06.2025
* Der vollständige Urteilstext wurde ausgeblendet, um die Lesbarkeit dieses Artikels zu verbessern. Klicken Sie auf den folgenden Link, um den vollständigen Text einzublenden.









