Übersicht
- 1 Das Wichtigste in Kürze
- 2 Der Fall vor Gericht
- 2.1 Muss ich eine exorbitant hohe Gasrechnung bezahlen, auch wenn ich glaube, der Zähler ist kaputt?
- 2.2 Was war genau passiert? Ein Autohaus und eine unerklärliche Gasrechnung
- 2.3 Wie hat sich das Autohaus gegen die Forderung gewehrt?
- 2.4 Warum ist ein geeichter Zähler vor Gericht so überzeugend? Der „Beweis des ersten Anscheins“
- 2.5 Konnte das Autohaus diesen Anscheinsbeweis erschüttern?
- 2.6 War die Prüfung des Gaszählers fehlerhaft, weil das Gehäuse nicht geöffnet wurde?
- 2.7 Hatte der Energieversorger eine Pflicht, das Autohaus früher zu warnen?
- 2.8 Wie kam das Gericht zu dem endgültigen Zahlbetrag?
- 3 Die Schlüsselerkenntnisse
- 4 Häufig gestellte Fragen (FAQ)
- 4.1 Welche rechtliche Bedeutung hat die Eichung und Prüfung von Energieverbrauchszählern?
- 4.2 Welche Schritte sollte man unternehmen, wenn man eine unerwartet hohe Verbrauchsabrechnung von seinem Energieversorger erhält?
- 4.3 Welche Herausforderungen bestehen beim Nachweis eines defekten Verbrauchszählers und welche Beweise sind hierfür erforderlich?
- 4.4 Was genau umfasst eine offizielle Befundprüfung eines Energieverbrauchszählers und welche Erkenntnisse kann sie liefern?
- 4.5 Besteht für Energieversorger eine allgemeine Pflicht, Kunden bei stark erhöhten Verbräuchen proaktiv zu warnen?
- 5 Glossar – Fachbegriffe kurz erklärt
- 6 Wichtige Rechtsgrundlagen
- 7 Das vorliegende Urteil
Zum vorliegenden Urteil Az.: A 3 O 202/22 | Schlüsselerkenntnis | FAQ | Glossar | Kontakt
Das Wichtigste in Kürze
- Gericht: Landgericht Konstanz
- Datum: 05.09.2024
- Aktenzeichen: A 3 O 202/22
- Verfahren: Klageverfahren
- Rechtsbereiche: Vertragsrecht, Energierecht, AGB-Recht
Beteiligte Parteien:
- Kläger: Ein Energieversorgungsunternehmen, das die Zahlung für einen außergewöhnlich hohen Gasverbrauch forderte.
- Beklagte: Ein Autohaus und dessen Komplementärin, die die Richtigkeit des gemessenen Gasverbrauchs anzweifelten und eine Verletzung von Aufklärungspflichten seitens der Klägerin geltend machten.
Worum ging es genau?
- Sachverhalt: Ein Energieversorgungsunternehmen forderte von einem Autohaus die Zahlung für einen im Jahr 2021 außergewöhnlich hohen Gasverbrauch, der mittels geeichtem Zähler gemessen wurde. Das Autohaus bestritt die Richtigkeit des Zählers, da der Verbrauch ein Vielfaches der Vorjahre betrug, und berief sich auf fehlende Aufklärung durch das Versorgungsunternehmen.
Welche Rechtsfrage war entscheidend?
- Kernfrage: Ist ein Energieversorgungsunternehmen berechtigt, die Zahlung für einen außergewöhnlich hohen Gasverbrauch zu fordern, der durch einen geeichten Zähler gemessen wurde, auch wenn der Kunde die Richtigkeit des Zählers anzweifelt und eine Befundprüfung das Zählergehäuse nicht öffnete, und bestehen gegebenenfalls Aufklärungs- oder Hinweispflichten des Versorgungsunternehmens bei ungewöhnlichen Verbrauchsspitzen?
Wie hat das Gericht entschieden?
- Klage teilweise stattgegeben und teilweise für erledigt erklärt: Die Beklagten wurden zur Zahlung eines Teils der Klageforderung verurteilt; ein anderer Teil des Rechtsstreits hatte sich durch eine Verrechnung der Klägerin erledigt.
- Kernaussagen der Begründung:
- Anscheinsbeweis für Zählerrichtigkeit nicht widerlegt: Das Gericht befand, dass der Anscheinsbeweis für die Richtigkeit des geeichten Gaszählers nicht erschüttert werden konnte, da die Befundprüfung keine Mängel zeigte und ein Sachverständiger nicht feststellen konnte, dass ein später festgestellter Zählerfehler bereits im streitgegenständlichen Zeitraum bestand oder den hohen Verbrauch erklären würde.
- Keine Verletzung von Hinweis- oder Aufklärungspflichten: Das Energieversorgungsunternehmen hatte keine unterjährige Pflicht, den Kunden über den außergewöhnlich hohen Verbrauch zu informieren, da die Beklagten nicht schlüssig darlegen konnten, dass ihnen der Mehrverbrauch unbekannt war und dies für die Klägerin erkennbar war.
- Kein Zurückbehaltungsrecht der Beklagten: Die Beklagten hatten kein Recht, die Zahlung zurückzuhalten, da die Befundprüfung des Zählers objektiv regelgerecht erfolgte und die Nichtöffnung des Zählergehäuses keinen Mangel der Prüfung darstellte.
- Folgen für die Klägerin:
- Die Klägerin erhielt eine Zahlung von 41.587,05 € zuzüglich Zinsen von den Beklagten.
- Der Rechtsstreit wurde in Höhe von 117.292,65 € als in der Hauptsache erledigt festgestellt, da die Klägerin diesen Betrag bereits mit einem Rückzahlungsanspruch der Beklagten verrechnet hatte.
- Der Anspruch der Klägerin auf Erstattung der vorgerichtlichen Rechtsanwaltskosten wurde abgewiesen.
Der Fall vor Gericht
Muss ich eine exorbitant hohe Gasrechnung bezahlen, auch wenn ich glaube, der Zähler ist kaputt?
Stellen Sie sich vor, Sie öffnen Ihre jährliche Gasrechnung und Ihnen stockt der Atem: Der geforderte Betrag ist viermal so hoch wie in den Vorjahren, obwohl Sie an Ihrem Heizverhalten nichts geändert haben. Ihr erster Gedanke ist wahrscheinlich: „Das kann nicht stimmen, der Zähler muss defekt sein!“ Genau mit dieser Situation sah sich ein Autohaus konfrontiert, das plötzlich eine Rechnung über fast 160.000 Euro erhielt. Der Fall landete vor dem Landgericht Konstanz, das eine grundlegende Frage klären musste: Wer trägt das Risiko, wenn ein Zähler einen unerklärlich hohen Verbrauch anzeigt, aber alle Prüfungen auf den ersten Blick in Ordnung scheinen?
Was war genau passiert? Ein Autohaus und eine unerklärliche Gasrechnung
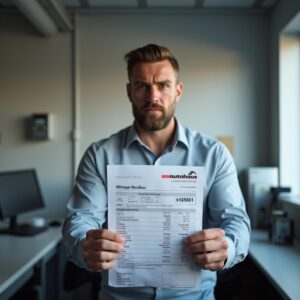
Ein Energieunternehmen belieferte ein Autohaus mit Gas. Über Jahre hinweg lag der durchschnittliche Jahresverbrauch bei rund 512.000 Kilowattstunden (kWh). Im Jahr 2021 explodierte der gemessene Verbrauch jedoch förmlich auf über 2.000.000 kWh – das ist das Vierfache des Üblichen. Entsprechend hoch fiel die Jahresrechnung aus: Das Energieunternehmen forderte 158.879,70 €.
Das Autohaus und seine persönlich haftende Gesellschafterin weigerten sich zu zahlen. Für sie war klar, dass dieser Verbrauch nicht real sein konnte. Sie hatten an ihren Abläufen nichts geändert und konnten sich den plötzlichen Anstieg nicht erklären. Um ihre Vermutung zu untermauern, beantragten sie bei der Netzbetreiberin – das ist das Unternehmen, dem die Leitungen und der Zähler gehören – eine sogenannte Befundprüfung. Darunter versteht man eine offizielle Überprüfung eines Messgeräts durch eine staatlich anerkannte Prüfstelle, um dessen Genauigkeit festzustellen. Das Autohaus bat ausdrücklich darum, das Gehäuse des Gaszählers bei dieser Prüfung zu öffnen.
Das Ergebnis der Prüfung war für das Autohaus ernüchternd: Die Prüfstelle bescheinigte, der Zähler habe die „Befundprüfung bestanden“. Im Prüfprotokoll stand jedoch auch der Hinweis, dass das Zählergehäuse nicht geöffnet worden war. Parallele Überprüfungen der Heizungsanlage durch den Schornsteinfeger und den Hersteller ergaben keine nennenswerten Fehler oder Lecks, die einen derartigen Mehrverbrauch hätten erklären können. Damit stand Aussage gegen Aussage: Auf der einen Seite ein geeichter und geprüfter Zähler, der einen riesigen Verbrauch anzeigte, auf der anderen Seite ein Kunde, der sicher war, diese Menge Gas niemals verbraucht zu haben.
Wie hat sich das Autohaus gegen die Forderung gewehrt?
Das Autohaus verteidigte sich mit mehreren Argumenten. Zuerst und vor allem bestritt es, dass der Zähler den Verbrauch korrekt gemessen habe. Der immense und unerklärliche Sprung im Verbrauch sei ein klares Indiz für einen Defekt.
Zweitens argumentierte es, die Befundprüfung sei mangelhaft gewesen. Warum? Weil die Prüfstelle dem Wunsch, das Zählergehäuse zu öffnen, nicht nachgekommen war. Dadurch sei die Prüfung nicht vollständig und das Ergebnis nicht aussagekräftig.
Drittens machte das Autohaus einen Gegenanspruch geltend. Es warf dem Energieunternehmen vor, seine Pflichten verletzt zu haben. Das Unternehmen hätte bereits während des Jahres bei der Zwischenablesung den extremen Anstieg bemerken und das Autohaus warnen müssen. Hätte es eine solche Warnung gegeben, hätte man der Ursache sofort nachgehen und den weiteren Schaden verhindern können. Juristen sprechen hier von einer Verletzung von Hinweis- und Aufklärungspflichten. Mit diesem angeblichen Schadensersatzanspruch wollte das Autohaus hilfsweise aufrechnen. Das bedeutet, es wollte seine eigene Forderung (Schadensersatz) gegen die Forderung des Energieunternehmens (Bezahlung der Rechnung) stellen, sodass sich beide gegenseitig aufheben.
Warum ist ein geeichter Zähler vor Gericht so überzeugend? Der „Beweis des ersten Anscheins“
Um die Entscheidung des Gerichts zu verstehen, müssen wir uns ein zentrales juristisches Prinzip anschauen: den Anscheinsbeweis, auch prima-facie-Beweis genannt. Das ist eine Art juristische Faustregel, die die Beweislast in bestimmten Situationen erleichtert.
Stellen Sie es sich wie ein versiegeltes Paket vor. Wenn ein Paket mit unversehrtem Siegel bei Ihnen ankommt, geht man zunächst davon aus, dass der Inhalt korrekt ist. Es spricht der „erste Anschein“ dafür. Wenn Sie nun behaupten, es sei etwas Falsches im Paket, müssen Sie beweisen, dass trotz des intakten Siegels etwas schiefgelaufen ist.
Übertragen auf den Gaszähler bedeutet das:
- Ein Gaszähler, der Geeicht ist – also von einer staatlichen Stelle auf seine Genauigkeit überprüft und versiegelt wurde – gilt erst einmal als korrekt funktionierend.
- Wenn dieser Zähler dann zusätzlich eine Befundprüfung durch eine anerkannte Prüfstelle besteht, wird dieser Anschein noch stärker.
Für den Kunden hat das eine wichtige Konsequenz: Behauptet der Energieversorger, der Zähler sei korrekt, und kann die Eichung und eine bestandene Prüfung vorweisen, muss der Kunde das Gegenteil beweisen. Es reicht nicht aus, nur zu sagen: „Der Verbrauch kann nicht stimmen.“ Der Kunde muss Tatsachen vorlegen, die die ernsthafte Möglichkeit eines Fehlers am Zähler belegen. Diesen Anscheinsbeweis zu „erschüttern“, ist eine hohe Hürde.
Konnte das Autohaus diesen Anscheinsbeweis erschüttern?
Nein, das gelang dem Autohaus nach Ansicht des Gerichts nicht. Obwohl der gemessene Verbrauch extrem hoch war, reichte dies allein nicht aus, um den starken Anscheinsbeweis für die Richtigkeit des Zählers zu widerlegen.
Das Gericht stützte sich dabei maßgeblich auf die Einschätzung eines gerichtlich bestellten Sachverständigen. Dieser Experte hatte den Zähler lange nach dem strittigen Zeitraum untersucht und tatsächlich einen Messfehler festgestellt. Aber – und das ist der entscheidende Punkt – er konnte nicht sagen, ob dieser Fehler bereits im Jahr 2021 bestanden hatte. Es war genauso denkbar, dass der Fehler erst durch den Transport oder den langen Zeitablauf entstanden war. Zudem hätte der von ihm festgestellte Fehler den gigantischen Mehrverbrauch bei Weitem nicht erklären können.
Das Gericht führte weiter aus, dass die Ungewissheit über die Ursache des hohen Verbrauchs zulasten des Kunden geht. Es zählte verschiedene denkbare, wenn auch nicht bewiesene Möglichkeiten auf:
- Es könnte unentdeckte oder inzwischen behobene Leckagen gegeben haben.
- Es könnten Geräte falsch eingestellt gewesen sein (eine Gasarmatur lief tatsächlich ineffizient).
- Theoretisch wäre sogar ein Gasdiebstahl denkbar.
Da der Verbrauch nicht so astronomisch hoch war, dass er ausschließlich durch einen Zählerdefekt erklärbar wäre, und das Autohaus keine konkreten Beweise für einen solchen Defekt im Jahr 2021 liefern konnte, blieb der Anscheinsbeweis bestehen. Das Autohaus musste sich den gemessenen Verbrauch zurechnen lassen.
War die Prüfung des Gaszählers fehlerhaft, weil das Gehäuse nicht geöffnet wurde?
Auch dieses Argument des Autohauses verwarf das Gericht. Der gerichtlich bestellte Sachverständige erklärte überzeugend, dass eine Öffnung des Zählergehäuses bei einer Standard-Befundprüfung nicht üblich und auch nicht notwendig sei. Die wesentlichen Funktionstests könnten von außen durchgeführt werden. Eine Öffnung diene eher dazu, Manipulationsspuren zu suchen, bringe aber für die Messgenauigkeit keine neuen Erkenntnisse.
Das Gericht schloss sich dem an. Die Prüfstelle hatte den Antrag des Autohauses nachvollziehbar so verstanden, dass das Zählwerk überprüft werden sollte, und genau das wurde getan. Die Prüfung war somit ordnungsgemäß. Damit entfiel auch das Recht des Autohauses, die Zahlung wegen einer angeblich mangelhaften Prüfung zurückzuhalten.
Hatte der Energieversorger eine Pflicht, das Autohaus früher zu warnen?
Das Gericht verneinte auch einen Schadensersatzanspruch wegen einer verletzten Hinweispflicht. Grundsätzlich muss ein Energieversorger den Verbrauch seiner Kunden nicht permanent überwachen und bei Auffälligkeiten Alarm schlagen. Eine solche Pflicht könnte allenfalls dann entstehen, wenn der Versorger erkennt, dass der Kunde den hohen Verbrauch offensichtlich nicht bemerkt und dadurch ein großer Schaden droht.
Hier hatte das Autohaus aber nicht ausreichend dargelegt, dass ihm der Mehrverbrauch tatsächlich unbekannt war und der Versorger dies hätte erkennen müssen. Schließlich handelt es sich um ein Gewerbe, bei dem Verbrauchsschwankungen vorkommen können. Ohne eine klare Pflichtverletzung gab es auch keinen Schadensersatzanspruch, mit dem das Autohaus hätte aufrechnen können.
Wie kam das Gericht zu dem endgültigen Zahlbetrag?
Die ursprüngliche Forderung betrug 158.879,70 €. In der Zwischenzeit hatte das Autohaus jedoch für das Folgejahr (2022), in dem der Verbrauch wieder normal war, hohe Abschlagszahlungen geleistet. Daraus ergab sich ein Guthaben für das Autohaus in Höhe von 117.292,65 €.
Dieses Guthaben verrechnete das Energieunternehmen selbst mit seiner offenen Forderung aus 2021. Juristen nennen diesen Vorgang Aufrechnung: Zwei Parteien schulden sich gegenseitig Geld, und anstatt hin und her zu zahlen, wird einfach die kleinere von der größeren Forderung abgezogen.
Nach dieser Verrechnung durch den Versorger blieb von der ursprünglichen Gasschuld noch ein Restbetrag von 41.587,05 € übrig. Das Gericht verurteilte das Autohaus und seine Gesellschafterin zur Zahlung genau dieses Restbetrags zuzüglich Zinsen. Die Kosten des gesamten Rechtsstreits musste ebenfalls das Autohaus tragen.
Die Schlüsselerkenntnisse
Das Landgericht Konstanz verdeutlicht mit seiner Entscheidung die hohen Beweishürden, die Energiekunden bei der Anfechtung von Verbrauchsabrechnungen überwinden müssen.
- Anscheinsbeweis bei geeichten Zählern: Das Urteil bestätigt, dass geeichte und erfolgreich befundgeprüfte Messgeräte einen starken Anscheinsbeweis für ihre Richtigkeit genießen, selbst bei extremen Verbrauchsanstiegen um das Vierfache. Allein die Ungewöhnlichkeit der Messwerte reicht nicht aus, um diesen Beweis zu erschüttern – vielmehr muss der Kunde konkrete Beweise für einen Zählerdefekt zum fraglichen Zeitpunkt vorlegen.
- Befundprüfungen ohne Gehäuseöffnung sind ausreichend: Das Gericht stellt klar, dass Standardbefundprüfungen auch ohne Öffnung des Zählergehäuses ordnungsgemäß sind, da die wesentlichen Funktionstests von außen durchgeführt werden können. Eine Gehäuseöffnung dient primär der Manipulationssuche und bringt für die Messgenauigkeitsprüfung keinen zusätzlichen Erkenntnisgewinn.
- Keine allgemeine Warnpflicht bei Verbrauchsanstiegen: Das Urteil zeigt, dass Energieversorger grundsätzlich nicht verpflichtet sind, Kunden bei ungewöhnlichen Verbrauchsentwicklungen proaktiv zu warnen. Eine solche Hinweispflicht entsteht nur in Ausnahmefällen, wenn der Versorger erkennt, dass dem Kunden der Mehrverbrauch offensichtlich unbekannt ist und großer Schaden droht.
Diese Rechtsprechung verdeutlicht, dass das Risiko ungeklärter Verbrauchsanstiege grundsätzlich beim Kunden liegt, wenn die Messinfrastruktur ordnungsgemäß funktioniert und geprüft wurde.
Zweifeln Sie die Richtigkeit eines ungewöhnlich hohen Gasverbrauchs an, der durch einen geeichten Zähler gemessen wurde? Lassen Sie Ihren spezifischen Fall unverbindlich durch unsere Experten prüfen und eine erste Orientierung erhalten über Ihre rechtlichen Möglichkeiten.
Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Welche rechtliche Bedeutung hat die Eichung und Prüfung von Energieverbrauchszählern?
Ein geeichter Energieverbrauchszähler, der eine offizielle Prüfung bestanden hat, gilt vor Gericht als korrekt, und wer das Gegenteil behauptet, muss dies beweisen. Dies schafft eine sehr starke rechtliche Vermutung für die Richtigkeit der angezeigten Messwerte.
Dieses Prinzip beruht auf dem sogenannten „Anscheinsbeweis“, einer Art juristischer Faustregel, die die Beweislast erleichtert. Stellen Sie sich einen amtlich versiegelten Behälter vor. Solange das Siegel intakt ist, geht man davon aus, dass der Inhalt korrekt ist. Genauso verhält es sich mit einem geeichten und erfolgreich geprüften Zähler: Seine Messungen werden als richtig angesehen, es sei denn, es wird das Gegenteil bewiesen.
Die Eichung bestätigt die Genauigkeit des Zählers durch eine staatliche Stelle, während eine zusätzlich bestandene Befundprüfung durch eine anerkannte Prüfstelle diesen Anschein der Richtigkeit noch verstärkt. Um diesen starken Beweis zu erschüttern, reicht es nicht aus, den gemessenen Verbrauch lediglich als unwahrscheinlich hoch zu empfinden. Vielmehr müssen konkrete Fakten vorgelegt werden, die einen Fehler des Zählers im strittigen Zeitraum belegen.
Die Nichtbeachtung dieser besonderen Beweislast kann für den Kunden zu hohen Kosten führen, da er den gemessenen Verbrauch begleichen muss, wenn kein konkreter Gegenbeweis für einen Zählerdefekt erbracht werden kann.
Welche Schritte sollte man unternehmen, wenn man eine unerwartet hohe Verbrauchsabrechnung von seinem Energieversorger erhält?
Erhält man eine unerwartet hohe Verbrauchsabrechnung, sollte man diese nicht sofort bezahlen, sondern umgehend die Ursache des erhöhten Verbrauchs gründlich prüfen. Es ist entscheidend, alle Schritte sorgfältig zu dokumentieren und gegebenenfalls eine offizielle Zählerprüfung zu beantragen.
Zunächst gilt es, den eigenen Verbrauch mit dem der Vorjahre oder eigenen Aufzeichnungen zu vergleichen, um die Ungewöhnlichkeit des Anstiegs zu belegen. Überprüfen Sie anschließend, ob in Ihrem Haushalt ungewöhnliche Verbräuche durch neue Geräte, geändertes Verhalten oder gar unentdeckte Leckagen vorliegen. Dies umfasst die Kontrolle von Geräten und Sichtkontrollen auf mögliche Fehlerquellen, ähnlich wie das Autohaus seine Heizungsanlage prüfen ließ.
Treten keine offensichtlichen Ursachen zutage, sollte der Energieversorger kontaktiert und um eine Erklärung gebeten werden. Ist die Situation weiterhin unklar, ist das Beantragen einer sogenannten „Befundprüfung“ des Zählers bei einer staatlich anerkannten Prüfstelle ratsam, um dessen korrekte Funktion festzustellen. Solch eine Prüfung ist ein wichtiger Schritt, um die Richtigkeit des Zählers zu überprüfen.
Durch dieses proaktive Vorgehen schaffen Sie eine fundierte Basis, um die Forderung zu hinterfragen und sich gegebenenfalls gegen die Abrechnung zu wehren. Die detaillierte Dokumentation aller Prüfungen und Korrespondenzen ist dabei unerlässlich.
Welche Herausforderungen bestehen beim Nachweis eines defekten Verbrauchszählers und welche Beweise sind hierfür erforderlich?
Eine der größten Herausforderungen beim Nachweis eines defekten Verbrauchszählers ist, dass die bloße Unplausibilität des Verbrauchs nicht ausreicht, um einen Fehler zu beweisen. Sie müssen konkret nachweisen, dass der Zähler zum Zeitpunkt des hohen Verbrauchs fehlerhaft war und dieser Fehler den Mehrverbrauch verursachen konnte.
Ein geeichter und von einer Prüfstelle erfolgreich überprüfter Zähler gilt juristisch als korrekt. Diesen „Beweis des ersten Anscheins“ für die Richtigkeit des Zählers zu erschüttern, ist eine hohe Hürde. Es genügt nicht, den hohen Verbrauch einfach anzuzweifeln oder ihn als unplausibel zu empfinden.
Man muss stattdessen konkrete Fakten vorlegen, die eine ernsthafte Möglichkeit eines Zählerfehlers im strittigen Zeitraum belegen. Es ist wie der Mechaniker, der ein Problem an Ihrem Auto erst nach dem Unfall findet: Er kann beweisen, dass jetzt ein Fehler da ist, aber nicht, ob dieser Fehler auch die Ursache des Unfalls damals war. Selbst wenn später ein Defekt festgestellt wird, muss bewiesen werden, dass dieser bereits im fraglichen Zeitraum existierte und den Mehrverbrauch tatsächlich erklärt. Im geschilderten Fall konnte der Gutachter zwar einen Fehler finden, aber nicht belegen, dass dieser schon 2021 vorlag oder den extremen Verbrauch erklären konnte.
Daher sind unabhängige Sachverständigengutachten entscheidend, die den Fehler kausal dem strittigen Verbrauchszeitraum zuordnen und seine Ursächlichkeit für den Mehrverbrauch plausibel darlegen können.
Was genau umfasst eine offizielle Befundprüfung eines Energieverbrauchszählers und welche Erkenntnisse kann sie liefern?
Eine offizielle Befundprüfung eines Energieverbrauchszählers ist eine staatlich anerkannte Überprüfung seiner Messgenauigkeit, die bestätigt, ob das Gerät innerhalb der zulässigen Abweichungen misst. Sie prüft primär die korrekte Funktion von außen, sucht aber in der Regel nicht gezielt nach Manipulationsspuren oder verborgenen Defekten, die eine Öffnung des Geräts erfordern würden.
Diese offizielle Überprüfung wird von einer unabhängigen, staatlich anerkannten Prüfstelle vorgenommen. Ihr Hauptziel ist es, die Messgenauigkeit des Geräts festzustellen und zu überprüfen, ob es die gesetzlich vorgeschriebenen Eichfehlergrenzen einhält. Das Ergebnis zeigt an, ob der Zähler den Energieverbrauch innerhalb dieser zulässigen Abweichungen korrekt erfasst.
Wie der Fall des Autohauses zeigte, ist bei einer Standard-Befundprüfung das Öffnen des Zählergehäuses in der Regel nicht vorgesehen und auch nicht notwendig, da die wesentlichen Funktionstests von außen durchgeführt werden können. Das bedeutet, eine Befundprüfung konzentriert sich auf die reine Messfunktion und deckt nicht unbedingt verdeckte Defekte oder Manipulationen auf, die nur durch eine Öffnung des Geräts sichtbar wären.
Das Bestehen einer solchen Befundprüfung erzeugt vor Gericht einen starken Beweis dafür, dass der Zähler korrekt funktioniert, was es für den Kunden schwierig macht, einen anderen Verbrauch nachzuweisen.
Besteht für Energieversorger eine allgemeine Pflicht, Kunden bei stark erhöhten Verbräuchen proaktiv zu warnen?
Energieversorger müssen Kunden grundsätzlich nicht proaktiv bei stark erhöhten Verbräuchen warnen. Eine allgemeine Überwachungs- und Warnpflicht besteht in der Regel nicht, es sei denn, es liegen besondere Umstände vor oder es gibt spezifische vertragliche Vereinbarungen.
Das Landgericht Konstanz hat dies in einem Fall bestätigt, bei dem ein Autohaus eine extrem hohe Gasrechnung erhielt. Das Autohaus argumentierte, der Energieversorger hätte es aufgrund des ungewöhnlichen Verbrauchs warnen müssen. Das Gericht verneinte jedoch einen solchen Schadensersatzanspruch wegen einer Verletzung von Hinweis- und Aufklärungspflichten.
Ein Energieversorger ist nicht verpflichtet, den Verbrauch seiner Kunden permanent zu überwachen und bei Auffälligkeiten Alarm zu schlagen. Eine Ausnahme könnte nur dann entstehen, wenn der Versorger erkennt, dass der Kunde den hohen Verbrauch offensichtlich nicht bemerkt und ihm dadurch ein großer Schaden droht. Solche Ausnahmen sind jedoch eng gefasst und erfordern, dass der Versorger eine klare Kenntnis von der Unwissenheit und der drohenden Gefahr hat. Gerichte differenzieren zudem oft zwischen verschiedenen Kundengruppen: Für Gewerbekunden wie das Autohaus wird eine höhere Eigenverantwortung bei der Kontrolle des Energieverbrauchs erwartet als möglicherweise bei Privatkunden.
Daher ist es für Kunden wichtig, ihren eigenen Energieverbrauch regelmäßig zu kontrollieren, um unerwartet hohe Rechnungen und mögliche Schäden zu vermeiden.
Hinweis: Bitte beachten Sie, dass die Beantwortung der FAQ Fragen keine individuelle Rechtsberatung darstellt und ersetzen kann. Alle Angaben im gesamten Artikel sind ohne Gewähr. Haben Sie einen ähnlichen Fall und konkrete Fragen oder Anliegen? Zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren. Wir klären Ihre individuelle Situation und die aktuelle Rechtslage.
Glossar – Fachbegriffe kurz erklärt
Anscheinsbeweis
Der Anscheinsbeweis ist ein juristisches Prinzip, das besagt, dass bei typischen Sachverhalten bestimmte Tatsachen als bewiesen gelten, solange nicht das Gegenteil widerlegt wird. Er erleichtert die Beweislast, indem er eine starke Vermutung für die Richtigkeit einer Sache schafft, die auf dem „ersten Anschein“ oder der allgemeinen Lebenserfahrung beruht. Im vorliegenden Fall wurde davon ausgegangen, dass ein geeichter und erfolgreich geprüfter Gaszähler korrekt funktioniert. Wer dies bestreitet, muss konkrete Gegenbeweise vorlegen, um diesen Anschein zu erschüttern.
Beispiel: Wenn ein Paket mit unversehrtem Siegel ankommt, geht man zunächst davon aus, dass der Inhalt korrekt ist, bis das Gegenteil bewiesen wird.
Aufrechnung
Die Aufrechnung ist ein rechtlicher Vorgang, bei dem zwei Parteien, die sich gegenseitig Geld schulden, ihre Forderungen miteinander verrechnen. Anstatt dass beide Parteien Zahlungen leisten, werden die Ansprüche miteinander saldiert, sodass am Ende nur noch der Überschussbetrag der größeren Forderung übrigbleibt oder sich die Forderungen ganz aufheben. Das Autohaus wollte seine angebliche Schadensersatzforderung gegen die Gasrechnung des Energieunternehmens „aufrechnen“, also gegenrechnen. Damit sollte erreicht werden, dass es weniger oder gar nichts bezahlen muss.
Befundprüfung
Eine Befundprüfung ist eine offizielle Untersuchung eines Messgeräts, wie eines Gaszählers, durch eine staatlich anerkannte Prüfstelle. Ihr Ziel ist es, die Messgenauigkeit des Geräts festzustellen und zu bescheinigen, ob es innerhalb der gesetzlich zulässigen Abweichungen misst (Eichfehlergrenzen). Diese Prüfung wird in der Regel von außen durchgeführt und dient dazu, die Funktionsfähigkeit des Zählwerks zu überprüfen. Besteht ein Zähler diese Prüfung, gilt er als korrekt funktionierend und verstärkt den „Anscheinsbeweis“ für die Richtigkeit der Verbrauchsmessung.
Geeicht
Als „geeicht“ wird ein Messgerät bezeichnet, das von einer staatlichen Stelle oder einer autorisierten Prüfstelle auf seine Messgenauigkeit überprüft und bestätigt wurde. Diese Eichung garantiert, dass das Gerät die gesetzlich vorgeschriebenen Toleranzen einhält und somit korrekte Messwerte liefert. Ein solcher geeichter Zähler gilt rechtlich als zuverlässig und seine Messwerte werden als richtig angesehen, bis das Gegenteil bewiesen wird. Die Eichung ist eine Voraussetzung für die Abrechnung des Verbrauchs gegenüber Kunden und bildet die Basis für den „Anscheinsbeweis“ der Richtigkeit.
Verletzung von Hinweis- und Aufklärungspflichten
Die Verletzung von Hinweis- und Aufklärungspflichten bedeutet, dass eine Partei es unterlassen hat, eine andere Partei über wichtige Umstände zu informieren, obwohl sie dazu verpflichtet gewesen wäre. Wenn aus dieser Pflichtverletzung ein Schaden entsteht, kann dies zu einem Schadensersatzanspruch führen. Im Fall des Autohauses wurde dem Energieversorger vorgeworfen, er hätte das Autohaus frühzeitig über den extrem hohen Gasverbrauch informieren und warnen müssen. Eine solche allgemeine Pflicht besteht jedoch in der Regel nicht, es sei denn, es liegen besondere Umstände vor, die eine Warnung zwingend erfordern.
Wichtige Rechtsgrundlagen
Anscheinsbeweis (Beweis des ersten Anscheins)
Dies ist ein juristisches Prinzip, das hilft, die Beweisführung in Fällen zu vereinfachen, in denen ein typischer Ablauf von Ereignissen oder ein typisches Ergebnis vorliegt. Man geht dann vom „ersten Anschein“ aus, dass etwas auf eine bestimmte Weise passiert ist, ohne dass dies im Detail bewiesen werden muss. Diese Annahme kann nur entkräftet werden, wenn die Gegenseite konkrete Tatsachen vorbringt, die die ernsthafte Möglichkeit eines anderen Geschehensablaufs aufzeigen.
→ Bedeutung im vorliegenden Fall: Der geeichte und erfolgreich befundegeprüfte Gaszähler des Energieversorgers schuf einen starken Anscheinsbeweis dafür, dass der angezeigte hohe Gasverbrauch korrekt war. Das Autohaus musste diesen Anschein erschüttern, indem es konkrete Fakten lieferte, die einen Zählerdefekt im streitigen Zeitraum wahrscheinlich machten. Das Gericht sah diese Hürde als nicht genommen an.
Beweislast
Die Beweislast regelt, welche Partei vor Gericht die Verantwortung trägt, eine bestimmte Behauptung zu beweisen, um den Fall zu gewinnen. Wenn eine Partei eine Behauptung aufstellt und diese nicht beweisen kann, geht der Fall in diesem Punkt zu ihren Lasten. Dies ist ein fundamentales Prinzip im Zivilprozess.
→ Bedeutung im vorliegenden Fall: Durch den Anscheinsbeweis für die Richtigkeit des Gaszählers verschob sich die Beweislast zum Autohaus. Das Autohaus musste beweisen, dass der Zähler im fraglichen Zeitraum fehlerhaft war und der gemessene Verbrauch nicht der Realität entsprach. Da es dies nicht zweifelsfrei nachweisen konnte – der Sachverständige fand einen späteren, geringen Fehler, aber keinen zeitgenössischen, den massiven Verbrauch erklärenden Fehler –, musste es den gemessenen Verbrauch akzeptieren.
Verletzung von Hinweis- und Aufklärungspflichten und Schadensersatz (vgl. § 280 Abs. 1 BGB, § 241 Abs. 2 BGB)
Parteien in einem Vertrag haben nicht nur Hauptpflichten (z.B. Lieferung von Gas und Bezahlung), sondern auch sogenannte Nebenpflichten. Dazu können Hinweis- und Aufklärungspflichten gehören, die dazu dienen, den Partner vor Schäden zu bewahren. Bei einer schuldhaften Verletzung solcher Pflichten kann ein Anspruch auf Schadensersatz entstehen, der den entstandenen Schaden ausgleichen soll.
→ Bedeutung im vorliegenden Fall: Das Autohaus machte einen Schadensersatzanspruch geltend, weil das Energieunternehmen es nicht frühzeitig vor dem drastisch erhöhten Verbrauch gewarnt habe. Das Gericht verneinte eine solche allgemeine Pflicht für den Energieversorger bei einem gewerblichen Kunden, da dieser selbst seinen Verbrauch überwachen und Schwankungen einschätzen können muss. Somit gab es keinen Anspruch, mit dem das Autohaus hätte aufrechnen können.
Aufrechnung (§§ 387 ff. BGB)
Die Aufrechnung ist eine Möglichkeit, gegenseitige Forderungen von zwei Parteien miteinander zu verrechnen, wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind. Anstatt dass beide Parteien Geld hin- und herüberweisen, wird die kleinere Forderung von der größeren abgezogen, und nur der Restbetrag muss noch gezahlt werden. Dies führt zu einer Vereinfachung des Zahlungsverkehrs und der Beendigung von Forderungen.
→ Bedeutung im vorliegenden Fall: Das Energieunternehmen hatte ein Guthaben des Autohauses aus dem Folgejahr (2022) mit der hohen Gasrechnung aus dem Jahr 2021 verrechnet. Durch diese Aufrechnung reduzierte sich die ursprünglich geforderte Summe von über 158.000 € auf den vom Gericht zugesprochenen Restbetrag von rund 41.500 €.
Das vorliegende Urteil
LG Konstanz – Az.: A 3 O 202/22
* Der vollständige Urteilstext wurde ausgeblendet, um die Lesbarkeit dieses Artikels zu verbessern. Klicken Sie auf den folgenden Link, um den vollständigen Text einzublenden.









