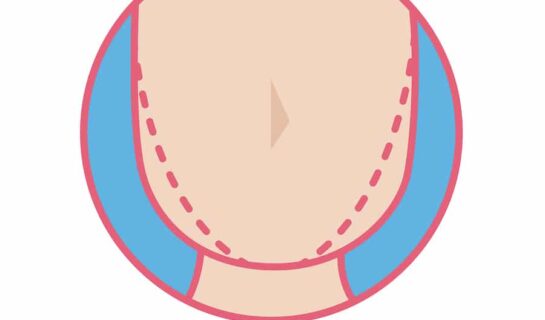Übersicht
- 1 Das Wichtigste in Kürze
- 2 Der Fall vor Gericht
- 2.1 Grundlegende Fakten zum Rechtsstreit
- 2.2 Der Weg zur fiktiven Schadensabrechnung
- 2.3 Streitpunkt: Tatsächliche versus fiktive Reparaturkosten
- 2.4 Die Entscheidungen der Vorinstanzen
- 2.5 Die Entscheidung des Bundesgerichtshofs (BGH)
- 2.6 Zentrale Argumente des BGH zur fiktiven Abrechnung
- 2.7 Konkrete Schadensberechnung im vorliegenden Fall
- 2.8 Bedeutung des Urteils für Betroffene
- 3 Die Schlüsselerkenntnisse
- 4 Benötigen Sie Hilfe?
- 5 Häufig gestellte Fragen (FAQ)
- 5.1 Was bedeutet „fiktive Schadensabrechnung“ bei einem Autounfall?
- 5.2 Kann ich nach einem Autounfall selbst entscheiden, ob ich mein Auto reparieren lasse oder den Schaden fiktiv abrechne?
- 5.3 Wie wirkt sich eine Reparatur im Ausland auf meine fiktive Schadensabrechnung aus?
- 5.4 Welche Nachweise benötige ich für eine fiktive Schadensabrechnung?
- 5.5 Was passiert, wenn die Versicherung die Kosten meiner fiktiven Schadensabrechnung kürzt?
- 6 Glossar – Fachbegriffe kurz erklärt
- 7 Wichtige Rechtsgrundlagen
- 8 Hinweise und Tipps
- 9 Das vorliegende Urteil
Zum vorliegenden Urteil Az.: VI ZR 300/24 | Schlüsselerkenntnis | FAQ | Glossar | Kontakt
Das Wichtigste in Kürze
- Gericht: Bundesgerichtshof
- Datum: 28. Januar 2025
- Aktenzeichen: VI ZR 300/24
- Verfahrensart: Revision
- Rechtsbereiche: Schadensersatzrecht, Verkehrsrecht
Beteiligte Parteien:
- Kläger: Fahrzeughalter, dessen in Deutschland zugelassenes Fahrzeug bei einem Unfall in Deutschland beschädigt wurde. Er ließ das Fahrzeug während eines Urlaubs in der Türkei reparieren, machte aber die tatsächlichen Kosten nicht geltend, sondern forderte Schadensersatz auf Basis eines deutschen Gutachtens.
- Beklagte: Der Haftpflichtversicherer des Unfallverursachers. Argumentierte (über die Vorinstanz), dass der Kläger nur die tatsächlich im Ausland angefallenen Kosten verlangen könne. Legte Revision gegen das Urteil des Landgerichts ein.
Worum ging es in dem Fall?
- Sachverhalt: Nach einem Verkehrsunfall in Deutschland ließ der Kläger sein Fahrzeug in der Türkei reparieren. Er verlangte vom gegnerischen Haftpflichtversicherer (Beklagte) Schadensersatz auf Basis der in einem deutschen Gutachten geschätzten Reparaturkosten (3.087,80 EUR netto), ohne die tatsächlichen Kosten der Reparatur in der Türkei anzugeben. Das Amtsgericht wies die Klage ab, das Landgericht gab ihr teilweise statt (auf Basis einer Haftungsquote von 40% zulasten der Beklagten).
- Kern des Rechtsstreits: Darf der Geschädigte Schadensersatz auf Basis der fiktiven Reparaturkosten laut deutschem Gutachten verlangen, auch wenn er das Fahrzeug tatsächlich im Ausland reparieren ließ und die dortigen (möglicherweise niedrigeren) Kosten nicht nennt?
Was wurde entschieden?
- Entscheidung: Die Revision der Beklagten wurde größtenteils zurückgewiesen, nämlich bezüglich der vom Landgericht zugesprochenen (anteiligen) Reparaturkosten, der darauf entfallenden Anwaltskosten und Zinsen. Im Übrigen wurde die Revision als unzulässig verworfen.
- Folgen: Die Beklagte muss den vom Landgericht festgestellten Schadensersatz zahlen (basierend auf 40% Haftung, davon 1.132,38 EUR für Reparaturkosten) und trägt die Kosten des Revisionsverfahrens. Das Urteil des Landgerichts ist in diesem Umfang rechtskräftig.
Der Fall vor Gericht
Grundlegende Fakten zum Rechtsstreit

Der Bundesgerichtshof (BGH) hat am 28. Januar 2025 unter dem Aktenzeichen VI ZR 300/24 ein wichtiges Urteil zur Berechnung von Schadensersatzansprüchen nach Verkehrsunfällen gefällt. Im Kern ging es um die Frage, wie Reparaturkosten zu ersetzen sind, wenn ein in Deutschland beschädigtes Fahrzeug im Ausland repariert wird. Geklagt hatte ein Autofahrer gegen die Haftpflichtversicherung des Unfallgegners.
Der Kläger, wohnhaft in Deutschland, erlitt im März 2022 in Meinerzhagen einen Verkehrsunfall, bei dem sein in Deutschland zugelassenes Fahrzeug beschädigt wurde. Die Haftung des Unfallgegners bzw. dessen Versicherung war dem Grunde nach unstrittig, jedoch bestand Uneinigkeit über die Höhe des zu leistenden Schadensersatzes, insbesondere bei den Reparaturkosten.
Der Weg zur fiktiven Schadensabrechnung
Um seinen Schaden zu beziffern, holte der Kläger ein Sachverständigengutachten ein. Dieses Gutachten schätzte die notwendigen Reparaturkosten auf 3.087,80 Euro netto. Auf Basis dieses Gutachtens machte der Kläger seine Ansprüche bei der gegnerischen Versicherung geltend. Diese Art der Schadensberechnung nennt man Fiktive Abrechnung, da sie auf geschätzten Kosten basiert.
Später ließ der Kläger sein Fahrzeug während eines Urlaubsaufenthalts in der Türkei vollständig und fachgerecht reparieren. Über die tatsächlichen Kosten, die für diese Reparatur in der Türkei anfielen, machte der Kläger im Gerichtsverfahren jedoch bewusst keine Angaben. Er bestand weiterhin auf der Erstattung der in Deutschland geschätzten Kosten.
Streitpunkt: Tatsächliche versus fiktive Reparaturkosten
Der Kläger forderte von der beklagten Versicherung insgesamt 4.178,05 Euro. Dieser Betrag setzte sich zusammen aus den geschätzten Reparaturkosten (3.087,80 Euro), merkantilem Minderwert, Sachverständigenkosten, Nutzungsausfallentschädigung und einer Unkostenpauschale. Die Versicherung weigerte sich, auf Basis der fiktiven Kosten zu zahlen.
Der zentrale Streitpunkt war: Darf der Geschädigte die höheren, in Deutschland geschätzten Reparaturkosten verlangen, auch wenn er das Fahrzeug nachweislich im Ausland – möglicherweise günstiger – hat reparieren lassen? Muss er die tatsächlichen, im Ausland angefallenen Kosten offenlegen und sich diese anrechnen lassen?
Die Entscheidungen der Vorinstanzen
Das Urteil des Amtsgerichts
Das zunächst zuständige Amtsgericht wies die Klage vollständig ab. Es begründete dies damit, dass die Klage unschlüssig sei. Nach Ansicht des Amtsgerichts könne der Kläger nur die tatsächlich im Ausland angefallenen Reparaturkosten verlangen. Da er diese aber nicht beziffert hatte, sei sein Anspruch nicht nachvollziehbar dargelegt.
Das Urteil des Landgerichts
Der Kläger legte gegen das Urteil Berufung ein. Das Landgericht Hagen änderte die Entscheidung des Amtsgerichts teilweise ab. Nach Einholung eines gerichtlichen Sachverständigengutachtens und unter Berücksichtigung einer Haftungsquote von 40% zulasten der Beklagten verurteilte es die Versicherung zur Zahlung von 1.583,48 Euro.
Davon entfielen 1.132,38 Euro auf die Reparaturkosten. Diese Summe ergab sich aus den vom Gerichtsgutachter festgestellten (fiktiven) Nettoreparaturkosten von 2.830,96 Euro, angewendet auf die Haftungsquote von 40%. Das Landgericht widersprach damit der Auffassung des Amtsgerichts und stellte klar, dass der Kläger nicht zur Angabe der tatsächlichen Kosten verpflichtet sei.
Das Landgericht verwies auf unterschiedliche Interpretationen eines früheren BGH-Urteils (VI ZR 24/13). Es schloss sich der Auffassung an, dass die Pflicht zur Darlegung tatsächlicher Kosten das Recht auf fiktive Abrechnung aushöhlen würde. Es ließ jedoch die Revision zum BGH zu, um diese grundlegende Rechtsfrage klären zu lassen.
Die Entscheidung des Bundesgerichtshofs (BGH)
Der Bundesgerichtshof prüfte die Entscheidung des Landgerichts auf die Revision der Beklagten hin, soweit es um die Berechnung der Reparaturkosten ging. Der BGH wies die Revision der Versicherung zurück und bestätigte damit im Ergebnis die Entscheidung des Landgerichts bei der Berechnung der Reparaturkosten.
Das höchste deutsche Zivilgericht stellte klar: Ein Geschädigter darf seinen Fahrzeugschaden auch dann auf Basis eines deutschen Sachverständigengutachtens fiktiv abrechnen, wenn er das Fahrzeug später im Ausland tatsächlich reparieren lässt. Eine Pflicht zur Offenlegung der möglicherweise niedrigeren ausländischen Reparaturkosten besteht nicht.
Die Voraussetzung für die fiktive Abrechnung ist lediglich, dass die Reparatur – sollte sie durchgeführt werden – sach- und fachgerecht erfolgt. Dass dies hier der Fall war, stand zwischen den Parteien nicht im Streit. Die fehlende Angabe zu den tatsächlichen Kosten in der Türkei war somit unerheblich.
Zentrale Argumente des BGH zur fiktiven Abrechnung
Der BGH bekräftigte damit seine ständige Rechtsprechung zum Schadensersatzrecht nach § 249 BGB. Danach hat der Geschädigte grundsätzlich die Wahl, wie er den Schaden beheben möchte. Er kann das Fahrzeug reparieren lassen oder sich den zur Reparatur erforderlichen Geldbetrag auszahlen lassen (fiktive Abrechnung).
Dieses Wahlrecht, so der BGH, würde unterlaufen, wenn der Geschädigte gezwungen wäre, die tatsächlichen Kosten einer erfolgten Reparatur offenzulegen und sich auf diese verweisen zu lassen. Die fiktive Abrechnung basiert auf den objektiv erforderlichen Kosten zur Wiederherstellung des Zustands vor dem Unfall am Wohnort des Geschädigten (hier: Deutschland).
Die Tatsache, dass der Kläger sein Fahrzeug in der Türkei reparieren ließ, ändert nichts an dem in Deutschland entstandenen Schaden und den hierzulande erforderlichen Kosten zur Behebung. Der Geschädigte soll durch den Schadensersatz so gestellt werden, als wäre der Unfall nicht passiert. Maßstab dafür sind die Kosten am deutschen Markt.
Das Gericht betonte, dass es keinen Unterschied machen dürfe, ob jemand sein Fahrzeug erst nach Erhalt der Versicherungsleistung repariert oder bereits vorher. Eine Pflicht zur Offenlegung tatsächlicher (ggf. niedrigerer) Kosten würde diejenigen benachteiligen, die ihr Fahrzeug zeitnah – vielleicht im Ausland – reparieren lassen.
Konkrete Schadensberechnung im vorliegenden Fall
Im konkreten Fall bestätigte der BGH somit die Berechnung des Landgerichts. Maßgeblich waren die vom gerichtlichen Sachverständigen ermittelten, in Deutschland üblichen Nettoreparaturkosten von 2.830,96 Euro. Unter Anwendung der festgestellten Haftungsquote von 40% ergab sich der zugesprochene Betrag von 1.132,38 Euro für die Reparaturkosten.
Die weiteren Schadenspositionen (Merkantiler Minderwert, Sachverständigenkosten etc.) wurden ebenfalls auf Basis der 40%-Quote berechnet und waren nicht zentraler Gegenstand des Revisionsverfahrens bezüglich der Berechnungsmethode. Der BGH verwarf die Revision insoweit als unzulässig oder unbegründet.
Bedeutung des Urteils für Betroffene
Dieses Urteil des BGH hat erhebliche praktische Bedeutung für Unfallgeschädigte. Es stärkt klar das Recht auf fiktive Abrechnung von Fahrzeugschäden. Geschädigte haben weiterhin die Freiheit zu entscheiden, ob und wie sie ihr Fahrzeug reparieren lassen.
Wer sein Fahrzeug nach einem Unfall beispielsweise im günstigeren Ausland (Heimatland, Urlaubsland) reparieren lässt, muss nicht befürchten, dass ihm nur die dort tatsächlich angefallenen Kosten erstattet werden. Er kann weiterhin die höheren, in Deutschland üblichen Reparaturkosten laut Gutachten von der gegnerischen Versicherung verlangen.
Entscheidend ist, dass der Anspruch auf Basis eines qualifizierten Gutachtens über die in Deutschland erforderlichen Reparaturkosten geltend gemacht wird. Die Versicherung kann den Geschädigten nicht auf eine günstigere Reparaturmöglichkeit im Ausland verweisen oder zur Offenlegung der tatsächlichen Kosten zwingen.
Dies gibt Geschädigten mehr Flexibilität und finanzielle Sicherheit. Sie sind nicht verpflichtet, die wirtschaftlich günstigste Reparaturmethode zu wählen. Der in Deutschland entstandene Schaden wird nach deutschen Maßstäben bewertet und entschädigt, unabhängig vom späteren Reparaturort.
Wichtig bleibt: Wenn eine Reparatur erfolgt ist, muss diese – sofern relevant – nachweislich sach- und fachgerecht durchgeführt worden sein. Das Urteil ändert nichts daran, dass bei konkreter Abrechnung (Vorlage einer Rechnung) nur die tatsächlich angefallenen Kosten (ggf. zuzüglich Mehrwertsteuer) erstattet werden. Hier ging es aber um den Fortbestand des Rechts zur fiktiven Abrechnung trotz erfolgter Reparatur.
Die Schlüsselerkenntnisse
Das Urteil bekräftigt das Recht von Unfallgeschädigten, zwischen fiktiver und konkreter Schadensabrechnung zu wählen, ohne die tatsächlichen Reparaturkosten nachweisen zu müssen. Geschädigte dürfen ihre Fahrzeugreparaturen im Ausland durchführen lassen und dennoch Schadensersatz auf Basis eines in Deutschland erstellten Gutachtens verlangen, auch wenn die tatsächlichen Reparaturkosten im Ausland möglicherweise niedriger waren. Diese Entscheidung stärkt die Dispositionsfreiheit von Unfallgeschädigten und bestätigt, dass die Versicherung nicht automatisch einen Nachweis über die tatsächlichen Reparaturkosten verlangen kann.
Benötigen Sie Hilfe?
Ihr Recht auf Schadensersatz durchsetzen
Sie sind in einen Verkehrsunfall verwickelt und die gegnerische Versicherung zahlt nicht die vollen Reparaturkosten? Viele Geschädigte stehen vor dem Problem, dass Versicherungen versuchen, Leistungen zu kürzen oder auf günstigere Reparaturmöglichkeiten im Ausland zu verweisen. Sie haben das Recht, Ihren Schaden auf Basis eines Gutachtens fiktiv abzurechnen, auch wenn Sie Ihr Fahrzeug bereits repariert haben.
Lassen Sie sich nicht von Versicherungen unter Druck setzen. Wir prüfen Ihren Fall sorgfältig, ermitteln die Ihnen zustehenden Ansprüche und setzen diese konsequent durch. Wir stehen Ihnen mit unserer Expertise zur Seite, um sicherzustellen, dass Sie den vollen Schadensersatz erhalten, der Ihnen zusteht.
Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Was bedeutet „fiktive Schadensabrechnung“ bei einem Autounfall?
Wenn Ihr Fahrzeug bei einem Unfall beschädigt wird, für den Sie nicht verantwortlich sind, haben Sie Anspruch auf Schadensersatz. Die fiktive Schadensabrechnung ist eine Möglichkeit, diesen Schadensersatz zu erhalten, ohne dass Sie das Fahrzeug tatsächlich reparieren lassen müssen.
Sie rechnen den Schaden also „fiktiv“, das heißt auf einer gedachten Grundlage, ab. Anstatt eine Reparaturrechnung bei der gegnerischen Versicherung einzureichen, legen Sie ein Sachverständigengutachten oder (bei kleineren Schäden) einen Kostenvoranschlag einer Werkstatt vor. Dieses Dokument beziffert die voraussichtlichen Kosten, die für eine fachgerechte Reparatur anfallen würden.
Ihre Entscheidungsfreiheit als Geschädigter
Der Grundgedanke dahinter ist Ihre Entscheidungsfreiheit (Dispositionsfreiheit) als Geschädigter. Nach dem Gesetz (§ 249 Bürgerliches Gesetzbuch) können Sie wählen: Entweder lassen Sie den ursprünglichen Zustand wiederherstellen (also das Auto reparieren) oder Sie verlangen den Geldbetrag, der für diese Wiederherstellung notwendig wäre.
Sie können sich also dafür entscheiden, den Geldbetrag zu erhalten und
- das Fahrzeug gar nicht oder nur teilweise zu reparieren,
- die Reparatur selbst durchzuführen,
- das beschädigte Fahrzeug zu verkaufen und das Geld anderweitig zu verwenden.
Was wird bei der fiktiven Abrechnung erstattet?
Die Versicherung des Unfallverursachers erstattet Ihnen auf Basis des Gutachtens oder Kostenvoranschlags die geschätzten Reparaturkosten.
Wichtig zu wissen: Bei der fiktiven Abrechnung werden in der Regel nur die Netto-Reparaturkosten erstattet, also der Betrag ohne die Mehrwertsteuer. Das liegt daran, dass die Mehrwertsteuer nur dann als Schaden anfällt, wenn sie auch tatsächlich durch eine Reparatur und die dazugehörige Rechnung bezahlt wurde. Lassen Sie Ihr Fahrzeug später doch noch reparieren und legen die Rechnung vor, können Sie die Mehrwertsteuer nachträglich erstattet bekommen.
Zusätzlich zu den reinen Reparaturkosten kann Ihnen unter Umständen auch eine merkantile Wertminderung zustehen. Das ist ein Ausgleich dafür, dass Ihr Fahrzeug auch nach einer fachgerechten Reparatur als Unfallwagen auf dem Markt weniger wert sein kann. Auch dieser Betrag wird im Gutachten ausgewiesen und kann fiktiv abgerechnet werden.
Der Nachweis des Schadens
Bei der fiktiven Schadensabrechnung ist das Sachverständigengutachten der zentrale Nachweis für die Höhe des Schadens. Es listet detailliert die erforderlichen Reparaturarbeiten, die benötigten Ersatzteile und die dafür anfallenden Kosten (üblicherweise auf Basis der Stundenverrechnungssätze einer markengebundenen Fachwerkstatt) auf. Bei kleineren Schäden (oft bis ca. 750 – 1.000 Euro Schadenhöhe) kann auch ein Kostenvoranschlag einer Werkstatt als Nachweis genügen.
Kann ich nach einem Autounfall selbst entscheiden, ob ich mein Auto reparieren lasse oder den Schaden fiktiv abrechne?
Ja, grundsätzlich haben Sie nach einem unverschuldeten Autounfall das Recht zu wählen, wie Sie den Schaden an Ihrem Fahrzeug ersetzt bekommen möchten. Das Gesetz gibt Ihnen hier eine Entscheidungsfreiheit.
Sie haben im Wesentlichen zwei Möglichkeiten:
- Konkrete Abrechnung (Reparatur): Sie lassen Ihr Fahrzeug in einer Werkstatt Ihrer Wahl reparieren. Die erforderlichen Reparaturkosten können Sie dann von der Versicherung des Unfallverursachers verlangen. Sie erhalten also den Betrag, der tatsächlich für die Instandsetzung angefallen ist (belegt durch die Rechnung).
- Fiktive Abrechnung (Geld statt Reparatur): Sie können sich auch dafür entscheiden, das Fahrzeug nicht (oder nur teilweise oder selbst) zu reparieren. Stattdessen können Sie von der gegnerischen Versicherung den Geldbetrag verlangen, der für eine vollständige Reparatur notwendig wäre. Die Grundlage für diesen Betrag ist in der Regel ein Sachverständigengutachten oder bei kleineren Schäden ein Kostenvoranschlag einer Werkstatt. Sie erhalten das Geld und können frei darüber verfügen.
Was bedeutet fiktive Abrechnung genau?
Bei der fiktiven Abrechnung bekommen Sie die geschätzten Netto-Reparaturkosten ausgezahlt. Das bedeutet: Die im Gutachten oder Kostenvoranschlag ausgewiesene Umsatzsteuer (Mehrwertsteuer) wird Ihnen nur dann erstattet, wenn sie auch tatsächlich angefallen ist – also wenn Sie das Auto reparieren lassen und eine Rechnung mit ausgewiesener Steuer vorlegen können. Rechnen Sie fiktiv ab, erhalten Sie den Betrag ohne Umsatzsteuer.
Gibt es Grenzen für dieses Wahlrecht?
Ja, Ihr Wahlrecht ist nicht unbegrenzt. Es gibt bestimmte Situationen, in denen Einschränkungen gelten:
- Wirtschaftlicher Totalschaden: Wenn die Reparaturkosten laut Gutachten unverhältnismäßig hoch sind im Vergleich zum Wert des Fahrzeugs vor dem Unfall (Wiederbeschaffungswert), liegt oft ein sogenannter wirtschaftlicher Totalschaden vor. Rechnen Sie in diesem Fall fiktiv ab, zahlt die Versicherung in der Regel nur den Wiederbeschaffungswert abzüglich des Restwerts Ihres beschädigten Autos. Der Restwert ist der Betrag, den Sie beim Verkauf des unreparierten Fahrzeugs noch erzielen könnten. Eine vollständige Reparatur auf Kosten der Versicherung ist dann nur unter bestimmten Voraussetzungen möglich (Stichwort: 130%-Regel), die bei der fiktiven Abrechnung aber keine Rolle spielen.
- Verkehrssicherheit: Auch wenn Sie sich für die fiktive Abrechnung entscheiden, bleibt Ihr Fahrzeug möglicherweise beschädigt und nicht mehr verkehrssicher. Die Auszahlung des Geldes ändert nichts daran. Sie dürfen mit einem nicht verkehrssicheren Fahrzeug nicht am Straßenverkehr teilnehmen.
Es ist also wichtig zu verstehen, dass Sie zwar die Wahl zwischen Reparatur und Auszahlung des Geldbetrages haben, diese Entscheidung aber je nach Schadenshöhe und Zustand des Fahrzeugs unterschiedliche Konsequenzen haben kann.
Wie wirkt sich eine Reparatur im Ausland auf meine fiktive Schadensabrechnung aus?
Wenn Sie nach einem Verkehrsunfall in Deutschland entscheiden, Ihr Fahrzeug im Ausland reparieren zu lassen, kann sich dies auf die Höhe des Schadensersatzes auswirken, den Sie erhalten, insbesondere wenn Sie ursprünglich auf Basis eines Kostenvoranschlags oder Gutachtens aus Deutschland (fiktiv) abrechnen wollten.
Grundsatz der fiktiven Abrechnung
Zunächst bedeutet fiktive Schadensabrechnung, dass Sie den Schaden an Ihrem Fahrzeug auf Grundlage eines Sachverständigengutachtens oder eines Kostenvoranschlags abrechnen können, ohne die Reparatur tatsächlich durchführen zu lassen oder sie selbst günstiger zu organisieren. Sie erhalten dann den Geldbetrag, der für eine fachgerechte Reparatur in einer deutschen Werkstatt (laut Gutachten, meist ohne Mehrwertsteuer) notwendig wäre.
Auswirkung der Reparatur im Ausland
Lassen Sie Ihr Fahrzeug jedoch tatsächlich im Ausland reparieren, wo die Kosten möglicherweise niedriger sind als in Deutschland, gilt eine wichtige Einschränkung. Der Bundesgerichtshof (BGH), Deutschlands höchstes Gericht für Zivilangelegenheiten, hat entschieden, dass in einem solchen Fall in der Regel nur die tatsächlich angefallenen Reparaturkosten aus dem Ausland erstattet werden müssen.
Der Grundgedanke dahinter ist das Verbot der ungerechtfertigten Bereicherung. Sie sollen durch den Schadensersatz so gestellt werden, als wäre der Unfall nicht passiert, aber Sie sollen keinen finanziellen Vorteil daraus ziehen. Würden Sie die (höheren) fiktiven deutschen Reparaturkosten erhalten, obwohl Sie tatsächlich (weniger) im Ausland bezahlt haben, wäre das ein solcher nicht gerechtfertigter Vorteil.
Nachweis der tatsächlichen Kosten
Wenn Sie also im Ausland reparieren lassen, müssen Sie der gegnerischen Versicherung in der Regel die konkrete Rechnung der Auslandsreparatur vorlegen. Die Versicherung wird ihren Schadensersatz dann auf Basis dieser nachgewiesenen, niedrigeren Kosten leisten. Die ursprüngliche (höhere) fiktive Kalkulation auf Basis des deutschen Gutachtens tritt in diesem Fall in den Hintergrund.
Zusammenfassend lässt sich sagen: Eine Reparatur im Ausland ist zwar möglich, führt aber bei der Schadensabrechnung dazu, dass Sie normalerweise nur die realen und nachgewiesenen Kosten dieser Auslandsreparatur ersetzt bekommen, auch wenn ein deutsches Gutachten höhere fiktive Kosten ausgewiesen hat.
Welche Nachweise benötige ich für eine fiktive Schadensabrechnung?
Bei einer fiktiven Schadensabrechnung nach einem Verkehrsunfall lassen Sie sich die voraussichtlichen Reparaturkosten auszahlen, ohne die Reparatur tatsächlich durchzuführen oder nachzuweisen. Um Ihren Anspruch auf diese Art der Entschädigung gegenüber der gegnerischen Versicherung geltend zu machen, benötigen Sie überzeugende Nachweise über die Höhe des entstandenen Schadens.
Das Schadensgutachten als zentrale Grundlage
Der wichtigste Nachweis für die Höhe des Schadens bei einer fiktiven Abrechnung ist in der Regel ein unabhängiges Schadensgutachten.
- Dieses Gutachten wird von einem qualifizierten und neutralen Kfz-Sachverständigen erstellt. Es dient dazu, den Schaden objektiv und nachvollziehbar festzustellen.
- Es beziffert detailliert die voraussichtlich anfallenden Reparaturkosten, die in einer Fachwerkstatt entstehen würden. Dabei werden übliche Stundenverrechnungssätze einer markengebundenen oder freien Fachwerkstatt zugrunde gelegt, je nach Alter und Zustand des Fahrzeugs.
- Das Gutachten ermittelt auch eine mögliche merkantile Wertminderung. Das ist der Betrag, um den Ihr Fahrzeug trotz (gedachter) vollständiger Reparatur aufgrund des Unfallschadens weniger wert ist.
- Liegt ein wirtschaftlicher Totalschaden vor (Reparaturkosten übersteigen den Wert des Fahrzeugs vor dem Unfall), weist das Gutachten den Wiederbeschaffungswert (Preis für ein gleichwertiges Ersatzfahrzeug) und den Restwert (Wert des beschädigten Fahrzeugs) aus. Die Differenz dieser beiden Werte bildet dann die Grundlage für die Abrechnung.
Das Gutachten stellt somit die objektive Berechnungsgrundlage dar, auf deren Basis die Versicherung den Schadensbetrag für die fiktive Abrechnung ermittelt. Bei einem unverschuldeten Unfall muss die Versicherung des Unfallverursachers die Kosten für das Sachverständigengutachten übernehmen, es sei denn, es handelt sich nur um einen Bagatellschaden (Schaden unterhalb einer Geringfügigkeitsgrenze, die oft bei etwa 750 bis 1000 Euro liegt).
Wichtige Ergänzung: Fotos vom Schaden und Unfallort
Zusätzlich zum Gutachten ist es sehr hilfreich, den Schaden und die Unfallsituation umfassend mit Fotos zu dokumentieren.
- Machen Sie möglichst direkt nach dem Unfall aussagekräftige Bilder von den beschädigten Stellen an Ihrem Fahrzeug. Fotografieren Sie dabei sowohl Übersichtsaufnahmen als auch Detailbilder der Schäden aus verschiedenen Winkeln.
- Fotografieren Sie auch die Unfallstelle. Bilder von der Verkehrssituation, den Positionen der beteiligten Fahrzeuge nach dem Zusammenstoß oder eventuellen Bremsspuren können wichtig sein.
Diese Fotos dienen als visueller Beleg für das Schadensbild und den Unfallhergang. Sie können das Gutachten sinnvoll ergänzen und helfen, mögliche Unklarheiten oder spätere Diskussionen über den Umfang des Schadens zu vermeiden. Sie unterstützen die Nachvollziehbarkeit des im Gutachten festgestellten Schadens.
Was passiert, wenn die Versicherung die Kosten meiner fiktiven Schadensabrechnung kürzt?
Wenn Sie nach einem Verkehrsunfall auf Basis eines Sachverständigengutachtens abrechnen möchten, ohne das Fahrzeug tatsächlich reparieren zu lassen (fiktive Abrechnung), kommt es häufig vor, dass die gegnerische Haftpflichtversicherung die im Gutachten ausgewiesenen Kosten kürzt. Solche Kürzungen müssen Sie jedoch nicht ohne Weiteres akzeptieren.
Warum kürzt die Versicherung?
Versicherungen prüfen die eingereichten Gutachten und nehmen teilweise Kürzungen bei bestimmten Positionen vor. Gründe hierfür können sein:
- Die angesetzten Stundenverrechnungssätze einer Markenwerkstatt werden nicht akzeptiert, stattdessen wird auf günstigere, freie Werkstätten verwiesen.
- UPE-Aufschläge (Aufschläge auf die unverbindliche Preisempfehlung für Ersatzteile) werden gekürzt oder gestrichen.
- Verbringungskosten (Kosten für den Transport des Fahrzeugs zu einer Lackiererei) werden nicht oder nur teilweise anerkannt.
- Die Kosten für bestimmte Arbeitsschritte oder Materialien werden als überhöht angesehen.
Die Versicherung begründet die Kürzungen oft mit Verweisen auf eigene Prüfberichte oder Durchschnittswerte.
Was basiert auf Ihrem Gutachten?
Grundlage für die fiktive Abrechnung ist in der Regel das von Ihnen eingeholte unabhängige Sachverständigengutachten. Dieses Gutachten ermittelt den Geldbetrag, der erforderlich ist, um den Schaden am Fahrzeug zu beheben (§ 249 Abs. 2 Satz 1 Bürgerliches Gesetzbuch – BGB). Das Gutachten dient als Nachweis für die Höhe des entstandenen Schadens.
Die Versicherung darf nicht pauschal kürzen. Sie muss konkret darlegen und begründen, warum die im Gutachten genannten Kosten nicht erforderlich oder überhöht sein sollen.
Die Beweislast liegt bei der Versicherung
Ein wichtiger Punkt für Sie als Geschädigten: Die Versicherung trägt die Beweislast dafür, dass das von Ihnen vorgelegte Gutachten fehlerhaft ist oder die darin kalkulierten Kosten nicht zur Schadensbehebung erforderlich sind.
Wenn die Versicherung beispielsweise behauptet, eine Reparatur sei in einer anderen, günstigeren Werkstatt in gleicher Qualität möglich, muss sie dies nachweisen. Sie muss auch darlegen, warum Ihnen als Geschädigten die Reparatur in dieser günstigeren Werkstatt zumutbar ist (z.B. hinsichtlich Entfernung und Qualitätsstandard).
Mögliche Schritte bei Kürzungen
Wenn die Versicherung die Kosten kürzt, bedeutet das nicht, dass Sie sich damit zufriedengeben müssen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, auf Kürzungen zu reagieren:
- Prüfung der Kürzungsgründe: Sehen Sie sich die Begründung der Versicherung genau an. Sind die Argumente nachvollziehbar und rechtlich haltbar?
- Stellungnahme des Sachverständigen: Oft kann der Sachverständige, der das Gutachten erstellt hat, eine fachliche Stellungnahme zu den Kürzungen der Versicherung abgeben und begründen, warum die kalkulierten Kosten korrekt sind.
- Einholung weiterer Informationen: Manchmal ist es hilfreich, Vergleichsangebote oder Bestätigungen von Werkstätten einzuholen, um die im Gutachten angesetzten Kosten zu untermauern.
- Juristische Klärung: Bei Streitigkeiten über die Höhe des Schadensersatzes kann die Einschaltung eines Rechtsanwalts zur Prüfung der Sach- und Rechtslage und zur Durchsetzung der Ansprüche in Betracht kommen.
Es ist wichtig zu verstehen, dass Sie als Geschädigter grundsätzlich Anspruch auf den Ersatz der erforderlichen Reparaturkosten haben, wie sie in einem korrekten Gutachten ausgewiesen sind. Unberechtigte Kürzungen durch die Versicherung müssen nicht hingenommen werden.
Hinweis: Bitte beachten Sie, dass die Beantwortung der FAQ Fragen keine individuelle Rechtsberatung ersetzen kann. Haben Sie konkrete Fragen oder Anliegen? Zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren – wir beraten Sie gerne.
Glossar – Fachbegriffe kurz erklärt
Haftung dem Grunde nach
Dies bedeutet, dass grundsätzlich feststeht, dass jemand für einen Schaden verantwortlich ist und dafür aufkommen muss. Im Text war unstrittig, dass die Versicherung des Unfallgegners für den Schaden am Auto des Klägers haften muss. Der Streit bestand nur noch über die Frage, in welcher Höhe der Schaden zu ersetzen ist (also über den „Betrag“). Die Klärung der Haftung dem Grunde nach ist meist der erste Schritt bei Schadensersatzforderungen.
Fiktive Abrechnung
Dies ist eine Art der Schadensberechnung, bei der der Geschädigte den Geldbetrag verlangen kann, der für die Reparatur objektiv notwendig wäre, auch wenn er das Fahrzeug gar nicht, nur teilweise oder günstiger reparieren lässt. Grundlage dafür ist § 249 Abs. 2 Satz 1 des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB), der dem Geschädigten ein Wahlrecht gibt. Im Text verlangte der Kläger die in Deutschland geschätzten (fiktiven) Reparaturkosten, obwohl die tatsächliche Reparatur in der Türkei erfolgte und deren Kosten unbekannt blieben. Der BGH bestätigte, dass dies zulässig ist.
Beispiel: Ein Gutachter schätzt die Reparaturkosten für eine Beule auf 500 Euro netto. Sie können diese 500 Euro von der gegnerischen Versicherung verlangen, auch wenn Sie die Beule selbst günstiger reparieren oder gar nicht reparieren lassen.
Merkantiler Minderwert
Dies bezeichnet den Wertverlust, den ein Fahrzeug nach einem Unfall trotz vollständiger und fachgerechter Reparatur erleidet. Der Grund dafür ist, dass ein repariertes Unfallfahrzeug auf dem Gebrauchtwagenmarkt in der Regel einen geringeren Preis erzielt als ein vergleichbares, unfallfreies Fahrzeug. Dieser „Makel“ stellt einen ersatzfähigen Schaden dar. Im Text war der merkantile Minderwert ein Teil der Summe, die der Kläger von der Versicherung forderte, zusätzlich zu den Reparaturkosten.
Nutzungsausfallentschädigung
Das ist eine finanzielle Entschädigung dafür, dass der Geschädigte sein Fahrzeug unfallbedingt vorübergehend nicht nutzen kann. Sie wird für die Dauer gewährt, die für die Reparatur oder die Beschaffung eines Ersatzfahrzeugs notwendig ist, sofern der Geschädigte in dieser Zeit keinen Mietwagen in Anspruch nimmt. Im vorliegenden Fall forderte der Kläger auch Nutzungsausfallentschädigung als Teil seines gesamten Schadensersatzanspruchs. Die Höhe wird meist anhand von Tabellen bestimmt, die sich nach dem Fahrzeugtyp richten.
Haftungsquote
Die Haftungsquote legt fest, zu welchem prozentualen Anteil die verschiedenen Beteiligten eines Unfalls für den entstandenen Schaden verantwortlich sind. Wenn nicht eine Partei allein die volle Schuld trägt, wird der Schaden entsprechend der Quote aufgeteilt (z. B. 70% zu 30%). Im Text wurde vom Landgericht eine Haftungsquote von 40% zu Lasten der Beklagten (also der Versicherung) festgelegt; das bedeutet, die Versicherung musste 40% des Schadens des Klägers tragen, während der Kläger die übrigen 60% seines Schadens selbst tragen musste (z. B. wegen Mitverschuldens oder Betriebsgefahr nach § 17 StVG).
§ 249 BGB (Bürgerliches Gesetzbuch)
Diese Vorschrift ist die Grundregel des deutschen Schadensersatzrechts. Absatz 1 bestimmt, dass der Schädiger den Zustand wiederherstellen muss, der ohne das schädigende Ereignis bestehen würde (sogenannte Naturalrestitution). Absatz 2 Satz 1 erlaubt es dem Geschädigten bei einer Sachbeschädigung (wie im Text dem Autoschaden), anstelle der Wiederherstellung (also der Reparatur) den dafür erforderlichen Geldbetrag zu verlangen. Auf diesem Wahlrecht basiert die im Text zentrale Möglichkeit der fiktiven Abrechnung der Reparaturkosten.
Wichtige Rechtsgrundlagen
- § 249 Abs. 2 BGB: Dieser Paragraph bestimmt, dass bei der Beschädigung einer Sache der Geschädigte statt der Naturalrestitution, also der tatsächlichen Reparatur, den zur Wiederherstellung erforderlichen Geldbetrag verlangen kann. Dies ermöglicht es Geschädigten, den Schaden fiktiv auf Gutachtenbasis abzurechnen, ohne Reparaturkosten nachweisen zu müssen. | Bedeutung im vorliegenden Fall: Ist entscheidend, da der Kläger Schadensersatz auf Basis eines Gutachtens verlangt, aber die Reparatur im Ausland durchgeführt hat. Die Frage ist, ob er trotzdem Anspruch auf die vollen, im Gutachten ermittelten Kosten hat oder nur auf die tatsächlich angefallenen, geringeren Kosten im Ausland.
- § 7 Abs. 1 StVG: Diese Vorschrift begründet die Gefährdungshaftung des Fahrzeughalters. Sie besagt, dass der Halter eines Kraftfahrzeugs zum Schadensersatz verpflichtet ist, wenn durch den Betrieb des Fahrzeugs ein Mensch getötet, verletzt oder eine Sache beschädigt wird. Diese Haftung ist verschuldensunabhängig. | Bedeutung im vorliegenden Fall: Bildet die Grundlage für den Schadensersatzanspruch des Klägers gegen die Beklagte als Haftpflichtversicherer des anderen Unfallbeteiligten. Durch den Unfall mit dem anderen Fahrzeug wurde das Fahrzeug des Klägers beschädigt, wodurch grundsätzlich ein Anspruch auf Schadensersatz entsteht.
- § 115 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 VVG: Dieser Paragraph statuiert den Direktanspruch des Geschädigten gegen den Haftpflichtversicherer des Schädigers. Der Geschädigte kann seine Schadensersatzansprüche direkt gegen die Versicherung geltend machen, anstatt sich nur an den Schädiger selbst wenden zu müssen. | Bedeutung im vorliegenden Fall: Ermöglicht es dem Kläger, seinen Anspruch auf Schadensersatz unmittelbar gegen die Beklagte als Haftpflichtversicherung des Unfallgegners zu richten. Dies vereinfacht die Durchsetzung von Ansprüchen erheblich.
- § 17 Abs. 1 StVG: Regelt die Haftungsverteilung bei Verkehrsunfällen, an denen mehrere Kraftfahrzeuge beteiligt sind. Sind die Beteiligten nicht allein verantwortlich, hängt die Verpflichtung zum Schadensersatz sowie der Umfang des Ersatzes von den Umständen, insbesondere davon ab, inwieweit der Schaden vorwiegend von dem einen oder anderen Teil verursacht worden ist. | Bedeutung im vorliegenden Fall: Das Urteil erwähnt eine Haftungsquote von 40% zu Lasten der Beklagten, was bedeutet, dass eine Abwägung der Verursachungsbeiträge stattgefunden hat. Dieser Paragraph ist relevant für die Festlegung des konkreten Anteils des Schadens, den die Beklagte übernehmen muss.
Hinweise und Tipps
Praxistipps für Autofahrer nach einem Unfall in Deutschland [bei/zum Thema Schadensersatz bei Reparatur im Ausland (Fiktive Abrechnung)]
Nach einem unverschuldeten Unfall in Deutschland stellt sich oft die Frage, wie der Schaden am besten behoben wird. Manchmal bietet es sich an, das Auto im Ausland reparieren zu lassen, zum Beispiel während eines Urlaubs. Hier erfahren Sie, welche Rechte Sie bei der Abrechnung mit der gegnerischen Versicherung haben.
Hinweis: Diese Praxistipps stellen keine Rechtsberatung dar. Sie ersetzen keine individuelle Prüfung durch eine qualifizierte Kanzlei. Jeder Einzelfall kann Besonderheiten aufweisen, die eine abweichende Einschätzung erfordern.
Tipp 1: Wahlfreiheit bei der Reparatur nutzen
Sie dürfen Ihr in Deutschland beschädigtes Auto auch im Ausland (z.B. in der Türkei) reparieren lassen. Für die Abrechnung mit der gegnerischen Haftpflichtversicherung können Sie trotzdem die (oft höheren) fiktiven Reparaturkosten laut einem deutschen Gutachten verlangen. Sie sind nicht gezwungen, nur die tatsächlich im Ausland gezahlten, möglicherweise niedrigeren Kosten geltend zu machen.
Tipp 2: Deutsches Gutachten als Basis
Lassen Sie den Schaden an Ihrem Fahrzeug unbedingt durch einen qualifizierten Sachverständigen in Deutschland begutachten. Dieses Gutachten beziffert die erforderlichen Reparaturkosten nach deutschen Standards (netto, also ohne Umsatzsteuer) und dient als Grundlage für Ihre Forderung gegenüber der Versicherung, wenn Sie fiktiv abrechnen möchten – auch wenn die Reparatur später tatsächlich im Ausland erfolgt.
Tipp 3: Fiktive Abrechnung klar kommunizieren
Sie haben das Recht, den Schaden auf Basis des deutschen Gutachtens (fiktiv) abzurechnen, ohne die tatsächliche Reparatur oder deren konkrete Kosten im Ausland nachweisen zu müssen. Teilen Sie der Versicherung klar mit, dass Sie die fiktive Abrechnung auf Gutachtenbasis wählen.
⚠️ ACHTUNG: Die Versicherung darf Sie nicht einfach auf die (ggf. niedrigeren) tatsächlichen ausländischen Reparaturkosten verweisen, wenn Sie sich für die fiktive Abrechnung entschieden haben. Das BGH-Urteil stärkt hier Ihre Position. Bestehen Sie auf Ihrem Recht zur fiktiven Abrechnung nach deutschem Gutachten.
Tipp 4: Finanzielle Flexibilität sichern
Die Möglichkeit der fiktiven Abrechnung, selbst wenn Sie das Fahrzeug günstiger im Ausland reparieren lassen, gibt Ihnen mehr Kontrolle und finanzielle Freiheit. Die Differenz zwischen den laut deutschem Gutachten geschätzten (höheren) Nettokosten und den tatsächlich im Ausland angefallenen (niedrigeren) Kosten dürfen Sie behalten.
Weitere Fallstricke oder Besonderheiten?
Bei der fiktiven Abrechnung wird grundsätzlich nur der Nettobetrag (ohne Mehrwertsteuer) aus dem Gutachten erstattet. Die Umsatzsteuer wird nur ersetzt, wenn sie tatsächlich angefallen ist und nachgewiesen wird. Bei einer Reparatur im Ausland kann der Nachweis und die Erstattung ausländischer Umsatzsteuer komplex sein und sollte gesondert geprüft werden. Die hier beschriebene Regelung gilt für Reparaturkosten; bei einem wirtschaftlichen Totalschaden gelten andere Grundsätze.
✅ Checkliste: Schadensersatz bei Auslandsreparatur (Fiktive Abrechnung)
- Unfallschaden in Deutschland durch qualifizierten Gutachter schätzen lassen?
- Entscheidung getroffen, fiktiv auf Basis des deutschen Gutachtens abzurechnen?
- Versicherung klar über die Wahl der fiktiven Abrechnung informiert?
- Deutsches Gutachten als Grundlage für die (Netto-)Forderung verwendet?
- Bei Ablehnung oder Verweis auf niedrigere Auslandskosten: Auf Recht zur fiktiven Abrechnung nach BGH VI ZR 300/24 berufen?
Das vorliegende Urteil
BGH – Az.: VI ZR 300/24 – Urteil vom 28.01.2025
* Der vollständige Urteilstext wurde ausgeblendet, um die Lesbarkeit dieses Artikels zu verbessern. Klicken Sie auf den folgenden Link, um den vollständigen Text einzublenden.