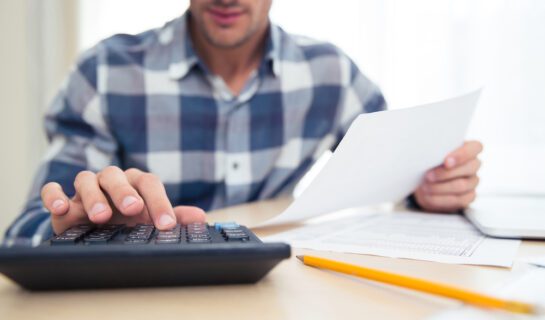Übersicht
- 1 Das Wichtigste in Kürze
- 2 Der Fall vor Gericht
- 2.1 OLG Hamm: Radfahrer nach Kollision mit Pedelec erfolglos – Kein Schmerzensgeld und Schadensersatz mangels Beweis für Schuld des Verstorbenen
- 2.2 Der Unfallhergang: Frontalzusammenstoß auf kombiniertem Geh- und Radweg N.
- 2.3 Streit um die Schuldfrage und Haftung: Wer fuhr falsch auf dem Radweg?
- 2.4 Erste Instanz Landgericht Münster: Teilerfolg für den Radfahrer trotz erheblichem Mitverschulden
- 2.5 Berufungsverfahren vor dem OLG Hamm: Beide Seiten fechten Urteil des Landgerichts an
- 2.6 OLG Hamm weist Klage vollständig ab: Kein Nachweis für unfallursächliches Fehlverhalten des Pedelec-Fahrers
- 2.7 Begründung des OLG Hamm: Aussage des Radfahrers als Beweis für Schuld nicht ausreichend (§ 286 ZPO)
- 2.8 Keine Haftung des Versicherers und abschließende Entscheidungen zu Kosten und Vollstreckbarkeit
- 2.9 Keine Revision zugelassen: Einzelfallentscheidung ohne grundsätzliche Bedeutung
- 3 Die Schlüsselerkenntnisse
- 4 Häufig gestellte Fragen (FAQ)
- 4.1 Was bedeutet das Rechtsfahrgebot für Radfahrer und wo ist es geregelt?
- 4.2 Was ist der Unterschied zwischen einem Gehweg, einem Radweg und einem kombinierten Geh- und Radweg?
- 4.3 Welche Rolle spielt die Beweislast bei einem Verkehrsunfall, insbesondere wenn ein Unfallbeteiligter verstorben ist?
- 4.4 Welche Ansprüche auf Schmerzensgeld und Schadensersatz können Radfahrer nach einem Unfall geltend machen?
- 4.5 Was bedeutet Mitverschulden und wie wirkt es sich auf die Höhe von Schmerzensgeld und Schadensersatz aus?
- 5 Glossar – Fachbegriffe kurz erklärt
- 6 Wichtige Rechtsgrundlagen
- 7 Das vorliegende Urteil
Zum vorliegenden Urteil Az.: 7 U 12/23 | Schlüsselerkenntnis | FAQ | Glossar | Kontakt
Das Wichtigste in Kürze
- Gericht: OLG Hamm
- Datum: 17.01.2025
- Aktenzeichen: 7 U 12/23
- Verfahrensart: Berufung
- Rechtsbereiche: Haftungsrecht, Deliktsrecht
Beteiligte Parteien:
- Kläger: Ein Fahrradfahrer, der bei einer Kollision verletzt wurde und Schadenersatz forderte.
- Beklagte: Die Erben des verstorbenen Pedelec-Fahrers sowie dessen privater Haftpflichtversicherer, die eine Haftung bestritten.
Worum ging es in dem Fall?
- Sachverhalt: Ein Zusammenstoß zwischen einem Fahrradfahrer und einem Pedelec-Fahrer auf einem kombinierten Geh- und Radweg, bei dem der Fahrradfahrer schwere Verletzungen erlitt. Der Pedelec-Fahrer verstarb später, seine Erben und sein Versicherer wurden verklagt.
- Kern des Rechtsstreits: Es ging darum, ob der verstorbene Pedelec-Fahrer den Unfall schuldhaft verursacht hatte, insbesondere durch einen Verstoß gegen das Rechtsfahrgebot, oder ob ein Fehlverhalten des Klägers ursächlich war.
Was wurde entschieden?
- Entscheidung: Das Gericht wies die Berufung des Klägers gegen den Versicherer als unzulässig und gegen die Erben als unbegründet zurück. Gleichzeitig gab es der Berufung der Erben statt und wies die Klage des Klägers in vollem Umfang ab.
- Begründung: Ein schuldhaftes unfallursächliches Verhalten des verstorbenen Pedelec-Fahrers konnte nicht bewiesen werden. Die Beweiswürdigung der ersten Instanz, die sich allein auf die vagen Angaben des Klägers stützte, war fehlerhaft und reichte nicht aus, um eine Pflichtverletzung des Pedelec-Fahrers festzustellen.
- Folgen: Der Kläger erhält keinen Schadensersatz von den Beklagten und muss die Kosten des Rechtsstreits tragen.
Der Fall vor Gericht
OLG Hamm: Radfahrer nach Kollision mit Pedelec erfolglos – Kein Schmerzensgeld und Schadensersatz mangels Beweis für Schuld des Verstorbenen
Das Oberlandesgericht (OLG) Hamm hat in einem Berufungsverfahren entschieden, dass ein Radfahrer, der bei einer Kollision mit einem Pedelec-Fahrer schwer verletzt wurde, keinen Anspruch auf Schmerzensgeld und Schadensersatz gegen die Erben des mittlerweile verstorbenen Pedelec-Fahrers hat.

Der zentrale Grund: Es konnte nicht nachgewiesen werden, dass der Pedelec-Fahrer den Unfall schuldhaft verursacht hat, insbesondere durch einen Verstoß gegen das Rechtsfahrgebot. Das Gericht wies die Klage des Radfahrers vollständig ab und änderte damit eine anderslautende Entscheidung der Vorinstanz.
Der Unfallhergang: Frontalzusammenstoß auf kombiniertem Geh- und Radweg N.
Der Unfall ereignete sich bereits im April 2016 in den frühen Morgenstunden auf einem kombinierten Geh- und Radweg an der H.-straße in N. Dieser Weg verlief parallel zur Fahrbahn und war durch einen Bordstein von dieser getrennt. Beteiligt waren zwei Radfahrer, die sich entgegenkamen: Der verletzte Radfahrer war mit seinem normalen Fahrrad unterwegs und nutzte den Weg in seiner Fahrtrichtung linksseitig, um nach N. zu gelangen. Ihm entgegen kam Herr O. auf seinem Pedelec (unterstützt bis 25 km/h), der den Weg in seiner Fahrtrichtung rechtsseitig in Richtung W. befuhr. Herr O. verstarb im Laufe des erstinstanzlichen Gerichtsverfahrens Ende 2019. Seine Erben traten als beklagte Parteien in den Prozess ein. Zusätzlich war der private Haftpflichtversicherer von Herrn O. eine beklagte Partei.
Der genaue Hergang des Zusammenstoßes, insbesondere die exakten Fahrlinien der beiden Radfahrer unmittelbar vor der Kollision, blieb während des gesamten Rechtsstreits streitig und konnte letztlich nicht aufgeklärt werden.
Streit um die Schuldfrage und Haftung: Wer fuhr falsch auf dem Radweg?
Der verletzte Radfahrer machte geltend, er sei auf dem Geh- und Radweg ganz rechts gefahren, entsprechend seiner Fahrtrichtung. Die Kollision sei allein dadurch verursacht worden, dass der entgegenkommende Pedelec-Fahrer, Herr O., das Rechtsfahrgebot missachtet habe. Er selbst habe den Unfall nicht verhindern können. Der Radfahrer vertrat zudem die Ansicht, dass er berechtigt gewesen sei, den für ihn linksseitigen Radweg zu benutzen. Als Beweis für seine Darstellung des Unfallhergangs bot der Radfahrer ausschließlich seine eigene Vernehmung als Partei an, hilfsweise seine Anhörung durch das Gericht.
Durch den Unfall zog sich der Radfahrer nach eigenen Angaben schwerste Verletzungen zu, darunter ein offenes Schädel-Hirn-Trauma sowie zahlreiche Knochenbrüche im Gesichtsschädelbereich (u.a. Stirnhöhlen, Augenhöhlen, Nasengerüst). Er forderte daher ein angemessenes Schmerzensgeld von mindestens 25.000 Euro sowie eine lebenslange monatliche Schmerzensgeldrente von 150 Euro. Darüber hinaus verlangte er Ersatz für materielle Schäden: Rund 2.480 Euro für beschädigte Gegenstände wie Uhr, Brille, Smartphone, Kleidung und sein Fahrrad sowie etwa 1.678 Euro für Fahrtkosten und Kosten einer Haushaltshilfe. Schließlich beantragte er die Feststellung, dass die Erben und der Versicherer gesamtschuldnerisch für alle künftigen unfallbedingten Schäden haften müssten.
Die Erben des verstorbenen Pedelec-Fahrers und dessen Versicherer beantragten die vollständige Abweisung der Klage. Sie bestritten die Darstellung des Radfahrers vehement. Herr O. sei korrekt auf seiner rechten Seite gefahren und habe keine Verkehrsregeln verletzt. Vielmehr sei der Unfall darauf zurückzuführen, dass der Radfahrer den Geh- und Radweg unberechtigterweise auf der für ihn falschen Seite befahren habe, da dieser nicht für den Gegenverkehr freigegeben gewesen sei. Die vom Radfahrer behaupteten Verletzungen und Dauerschäden wurden von den Erben und dem Versicherer mit Nichtwissen bestritten.
Erste Instanz Landgericht Münster: Teilerfolg für den Radfahrer trotz erheblichem Mitverschulden
Das Landgericht Münster hörte den verletzten Radfahrer persönlich an. Dieser gab an, er habe kurz vor dem Unfall aus der Ferne ein Licht gesehen und sei daraufhin „ganz weit rechts“ gefahren. An den genauen Moment der Kollision könne er sich jedoch nicht mehr erinnern. Das Landgericht holte zudem medizinische Gutachten zu den Verletzungsfolgen ein.
Mit Urteil vom 06.01.2023 gab das Landgericht Münster der Klage teilweise statt. Es verurteilte die Erben des Herrn O. als Gesamtschuldner zur Zahlung eines Schmerzensgeldes von 3.500 Euro, zum Ersatz materieller Schäden in Höhe von 164,55 Euro sowie zur Übernahme vorgerichtlicher Anwaltskosten. Außerdem stellte es die Haftung der Erben für künftige Schäden fest. Die weitergehenden Forderungen des Radfahrers wurden jedoch abgewiesen.
Die Begründung des Landgerichts stützte sich maßgeblich auf die Angaben des Radfahrers in seiner Anhörung. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der Pedelec-Fahrer Herr O. eine Sorgfaltspflicht verletzt habe, indem er sich nicht „äußerst weit rechts“ gehalten habe, obwohl der entgegenkommende Radfahrer für ihn erkennbar gewesen sei. Gleichzeitig lastete das Landgericht dem Radfahrer jedoch ein überwiegendes Mitverschulden von zwei Dritteln (2/3) an, da er den für seine Fahrtrichtung linken Radweg nicht hätte benutzen dürfen. Die Klage gegen den Haftpflichtversicherer wurde vollständig abgewiesen, da für diesen keine direkte Anspruchsgrundlage (Passivlegitimation) bestehe.
Berufungsverfahren vor dem OLG Hamm: Beide Seiten fechten Urteil des Landgerichts an
Gegen das Urteil des Landgerichts Münster legten sowohl der verletzte Radfahrer als auch die Erben des Pedelec-Fahrers Berufung beim Oberlandesgericht Hamm ein. Der Radfahrer verfolgte seine ursprünglichen Klageziele gegen alle Beklagten (Erben und Versicherer) weitgehend unverändert weiter und strebte eine 100%-ige Haftung der Gegenseite an. Er kritisierte insbesondere die Beweiswürdigung des Landgerichts bezüglich der Haftungsquote und wiederholte seine Argumentation zur alleinigen Schuld des Pedelec-Fahrers. Er bemängelte zudem, dass das Landgericht die polizeiliche Ermittlungsakte nicht ausreichend berücksichtigt und die aufnehmenden Polizeibeamten nicht vernommen habe – ein Vorwurf, der sich später als unzutreffend herausstellte.
Die Erben des Herrn O. beantragten mit ihrer Berufung die vollständige Abweisung der Klage, soweit ihr das Landgericht stattgegeben hatte. Sie machten ebenfalls Rechtsfehler im erstinstanzlichen Urteil geltend und bestritten erneut jegliches Fehlverhalten des Verstorbenen. Der Unfall sei allein durch das Fehlverhalten des Radfahrers (Nutzung der falschen Wegseite) verursacht worden.
Das OLG Hamm hörte den Radfahrer in der mündlichen Verhandlung am 17. Januar 2025 erneut persönlich an.
OLG Hamm weist Klage vollständig ab: Kein Nachweis für unfallursächliches Fehlverhalten des Pedelec-Fahrers
Das Oberlandesgericht Hamm kam zu einer grundlegend anderen Bewertung als das Landgericht und fällte folgende Entscheidung:
- Die Berufung des Radfahrers gegen den Haftpflichtversicherer wurde als unzulässig verworfen. Der Grund hierfür war ein formaler Mangel: Die Berufungsbegründung enthielt keine ausreichenden Argumente, warum die erstinstanzliche Abweisung der Klage gegen den Versicherer fehlerhaft sein sollte, wie es § 520 Abs. 3 ZPO vorschreibt. Zudem besteht im deutschen Recht grundsätzlich kein Direktanspruch gegen den privaten Haftpflichtversicherer des Schädigers.
- Die Berufung des Radfahrers gegen die Erben des Pedelec-Fahrers wurde als unbegründet zurückgewiesen.
- Die Berufung der Erben gegen das Urteil des Landgerichts Münster wurde als begründet angesehen.
- Folglich wurde das Urteil des Landgerichts Münster abgeändert und die Klage des Radfahrers in vollem Umfang abgewiesen.
- Die Kosten des gesamten Rechtsstreits wurden dem Radfahrer auferlegt.
Begründung des OLG Hamm: Aussage des Radfahrers als Beweis für Schuld nicht ausreichend (§ 286 ZPO)
Das OLG Hamm begründete seine Entscheidung umfassend:
Zunächst stellte das Gericht klar, dass Ansprüche aus der Gefährdungshaftung nach dem Straßenverkehrsgesetz (§§ 7, 17 StVG) ausscheiden, da an dem Unfall keine Kraftfahrzeuge beteiligt waren. In Betracht kamen daher ausschließlich deliktische Ansprüche nach dem Bürgerlichen Gesetzbuch (§ 823 Abs. 1 BGB wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung bzw. § 823 Abs. 2 BGB in Verbindung mit Schutzgesetzen wie § 229 StGB – fahrlässige Körperverletzung).
Die Voraussetzungen für solche Ansprüche sah das OLG Hamm jedoch als nicht erfüllt an. Zwar hat der Radfahrer unstreitig erhebliche Verletzungen und Schäden erlitten. Es konnte aber nicht zur Überzeugung des Gerichts festgestellt werden, dass diese Schäden auf ein schuldhaftes Verhalten des verstorbenen Pedelec-Fahrers Herrn O. zurückzuführen sind. Ein solches schuldhaftes Verhalten käme hier konkret nur als Verstoß gegen das Rechtsfahrgebot (§ 2 Abs. 2 StVO) in Betracht, das auch für Radfahrer auf Radwegen gilt.
Das OLG Hamm kritisierte die Beweiswürdigung des Landgerichts als fehlerhaft. Das Landgericht hatte seine Überzeugung von einem Verstoß des Herrn O. allein auf die Angaben des Radfahrers in dessen persönlicher Anhörung nach § 141 ZPO gestützt. Eine solche Parteianhörung ist jedoch nach gefestigter Rechtsprechung grundsätzlich kein förmliches Beweismittel (im Gegensatz zur strengeren Parteivernehmung nach §§ 445 ff. ZPO). Obwohl der Inhalt einer Anhörung im Rahmen der freien Beweiswürdigung (§ 286 ZPO) berücksichtigt werden muss, reicht sie allein – insbesondere bei widersprüchlichen Darstellungen der Parteien und wenn der Angehörte ein erhebliches Eigeninteresse am Ausgang hat – nicht aus, um eine für eine Verurteilung erforderliche, vernünftige Zweifel ausschließende Überzeugung des Gerichts zu begründen.
Zudem bewertete das OLG die Aussagen des Radfahrers auch inhaltlich als zu vage und unzureichend. Die Angaben („von weitem Licht gesehen“, „ganz weit rechts gefahren“, keine Erinnerung an die Kollision selbst) schilderten keinen schlüssigen Unfallhergang. Sie erlaubten keinen sicheren Rückschluss darauf, dass Herr O. tatsächlich gegen das Rechtsfahrgebot verstoßen hat und dieser Verstoß unfallursächlich war. Auch die in der Berufungsinstanz wiederholte Anhörung des Radfahrers brachte keine Klarheit. Dessen Schätzung, er sei etwa 30 cm vom rechten Bordstein entfernt gefahren, basierte nur auf seiner „üblichen Fahrweise“ und war zu unpräzise. Der Radfahrer konnte den konkreten Ablauf des Zusammenstoßes und den Berührungspunkt der Räder nicht beschreiben. Angesichts der bekannten, typischerweise leicht schwankenden Fahrlinie von Radfahrern und der relativ geringen Wegbreite von nur 2,25 Metern (laut Akte), lässt die vage Angabe des Radfahrers keinen zwingenden Schluss auf eine fehlerhafte, zu weit links befindliche Fahrposition des entgegenkommenden Pedelec-Fahrers zu.
Weitere Beweismittel, die den Unfallhergang hätten aufklären können, wurden vom Radfahrer nicht benannt oder waren unergiebig. Die vom Radfahrer erwähnten Polizeibeamten konnten zum eigentlichen Kollisionsvorgang keine Angaben machen. Die polizeiliche Ermittlungsakte, die entgegen der Behauptung des Radfahrers sehr wohl vom Landgericht beigezogen und ausgewertet worden war, enthielt ebenfalls keine Erkenntnisse, die sichere Rückschlüsse auf die konkreten Fahrlinien der Beteiligten zugelassen hätten.
Im Ergebnis blieb der konkrete Unfallhergang ungeklärt. Da eine schadensursächliche Sorgfaltspflichtverletzung des Herrn O. nicht bewiesen ist, scheitert der Schadensersatzanspruch des Radfahrers. Die Beweislast für das Vorliegen der anspruchsbegründenden Tatsachen – also auch für das schuldhafte Verhalten des Schädigers – trägt aber derjenige, der den Anspruch geltend macht, hier also der verletzte Radfahrer. Da ihm dieser Beweis nicht gelungen ist, musste die Klage gegen die Erben vollständig abgewiesen werden.
Keine Haftung des Versicherers und abschließende Entscheidungen zu Kosten und Vollstreckbarkeit
Die Entscheidung über die Kosten des Rechtsstreits folgt dem Grundsatz, dass die unterlegene Partei die Kosten trägt (§§ 91, 97 ZPO). Da der Radfahrer mit seiner Klage und seiner Berufung vollständig erfolglos blieb, muss er sämtliche Kosten tragen. Die Regelungen zur vorläufigen Vollstreckbarkeit der Urteile beruhen auf §§ 708 Nr. 10, 711 ZPO.
Keine Revision zugelassen: Einzelfallentscheidung ohne grundsätzliche Bedeutung
Das OLG Hamm hat die Revision zum Bundesgerichtshof nicht zugelassen. Die Rechtssache habe keine grundsätzliche Bedeutung, und eine Entscheidung des Revisionsgerichts sei weder zur Fortbildung des Rechts noch zur Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung erforderlich (§ 543 Abs. 2 ZPO). Es handle sich um eine Einzelfallentscheidung, die auf der Grundlage gefestigter Rechtsprechung zur Beweislast und Beweiswürdigung im Zivilprozess getroffen wurde. Das Urteil ist somit rechtskräftig.
Die Schlüsselerkenntnisse
Das OLG Hamm-Urteil verdeutlicht, dass bei Radunfällen die Beweislast für schuldhaftes Verhalten des Gegners beim Kläger liegt und allein dessen eigene Aussage als Beweis nicht ausreicht, besonders wenn detaillierte Erinnerungen an den Unfallhergang fehlen. Der Fall zeigt auch, wie schwierig die Beweisführung bei Kollisionen ohne Zeugen oder eindeutige Spuren sein kann. Für Radfahrer ergibt sich daraus die praktische Konsequenz, dass sie nach Unfällen möglichst schnell Beweise sichern sollten, etwa durch Fotos oder Zeugenaussagen, um ihre Ansprüche durchsetzen zu können.
Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Was bedeutet das Rechtsfahrgebot für Radfahrer und wo ist es geregelt?
Das Rechtsfahrgebot ist eine grundlegende Regel im deutschen Straßenverkehr. Es besagt, dass Sie als Verkehrsteilnehmer – und das schließt auch Radfahrer ein – grundsätzlich die rechte Seite der Fahrbahn oder des Weges benutzen müssen. Sie sollen also möglichst weit rechts fahren.
Dieses Gebot dient dazu, den Verkehr flüssig und sicher zu gestalten. Wenn jeder so weit rechts wie möglich fährt, ermöglicht dies anderen Fahrzeugen das Überholen und reduziert die Gefahr von Unfällen.
Wo ist das geregelt? Das Rechtsfahrgebot findet sich in der Straßenverkehrsordnung (StVO). Die maßgebliche Vorschrift ist § 2 Absatz 2 StVO. Darin steht geschrieben, dass man möglichst weit rechts fahren muss, nicht nur auf Fahrbahnen, sondern auch auf Radwegen, wenn solche vorhanden sind.
Für Radfahrer bedeutet das, dass sie in der Regel am rechten Fahrbahnrand oder auf einem vorhandenen, benutzungspflichtigen Radweg fahren müssen. Es gibt allerdings Situationen, in denen Radfahrer auch weiter links fahren dürfen oder sogar müssen. Beispiele dafür sind:
- Wenn Sie links abbiegen möchten.
- Wenn die Fahrbahn stark beschädigt oder durch parkende Autos blockiert ist.
- Wenn Sie einen ausreichenden Sicherheitsabstand zu Hindernissen am Fahrbahnrand (wie Gullideckeln oder Parklücken) einhalten müssen.
Trotz dieser Ausnahmen bleibt das Rechtsfahrgebot das Grundprinzip. Ein Verstoß kann Folgen haben, insbesondere wenn es zu einer Gefährdung oder einem Unfall kommt.
Was ist der Unterschied zwischen einem Gehweg, einem Radweg und einem kombinierten Geh- und Radweg?
Wenn Sie unterwegs sind, sei es zu Fuß oder mit dem Fahrrad, begegnen Ihnen verschiedene Arten von Wegen. Ihre Beschilderung und Markierung geben vor, wer diesen Weg nutzen darf und manchmal auch muss. Die Unterscheidung ist wichtig für die Sicherheit und um sich regelkonform im Verkehr zu bewegen.
Der Gehweg
Der Gehweg ist, wie der Name schon sagt, primär für Fußgänger bestimmt. Er ist baulich von der Fahrbahn getrennt, oft durch einen Bordstein.
- Nutzung: Fußgänger haben hier Vorrang.
- Andere Verkehrsteilnehmer: In der Regel dürfen keine Fahrräder oder andere Fahrzeuge auf dem Gehweg fahren. Es gibt seltene Ausnahmen, zum Beispiel für sehr kleine Kinder auf Fahrrädern oder in bestimmten, extra ausgewiesenen Bereichen (oft durch Zusatzschilder gekennzeichnet).
Der Radweg
Der Radweg ist speziell für Fahrräder vorgesehen. Er kann ebenfalls baulich von der Fahrbahn getrennt sein oder als markierter Streifen auf der Fahrbahn verlaufen.
- Nutzung: Dieser Weg ist in erster Linie für Radfahrer gedacht.
- Benutzungspflicht: Viele Radwege sind mit einem runden blauen Schild gekennzeichnet, das ein Fahrrad (oft auch mit einem Fußgänger darunter oder daneben) zeigt. Ist auf diesem blauen Schild nur ein Fahrrad abgebildet (Zeichen 237 StVO), müssen Radfahrer diesen Weg grundsätzlich benutzen, wenn er benutzbar ist.
- Fußgänger: Fußgänger dürfen Radwege in der Regel nicht benutzen, es sei denn, dies ist ausdrücklich erlaubt (z.B. durch Zusatzschilder).
Der kombinierte Geh- und Radweg
Ein kombinierter Geh- und Radweg ist ein Weg, der sowohl von Fußgängern als auch von Radfahrern gemeinsam genutzt werden darf oder muss. Dies wird ebenfalls durch ein rundes blaues Schild angezeigt, auf dem sowohl ein Fußgänger als auch ein Fahrrad abgebildet sind (Zeichen 240 StVO).
- Nutzung: Fußgänger und Radfahrer teilen sich diesen Weg.
- Regeln für die gemeinsame Nutzung: Oft ist auf solchen Wegen Rücksichtnahme besonders wichtig. Manchmal ist der Weg durch eine Markierung in einen Bereich für Fußgänger und einen für Radfahrer aufgeteilt (Zeichen 241-31 StVO), die dann jeweils nur ihren Bereich nutzen dürfen (geteilt). Wenn keine Trennung markiert ist (Zeichen 241-30 StVO), müssen alle Nutzer aufeinander achten (gemeinsam).
- Benutzungspflicht: Wie beim reinen Radweg bedeutet das blaue Schild mit den beiden Symbolen, dass dieser Weg von beiden Nutzergruppen benutzt werden muss, sofern er benutzbar ist.
Für Sie als Verkehrsteilnehmer ist es daher wichtig, auf die Beschilderung und eventuelle Markierungen auf dem Weg zu achten. Diese zeigen Ihnen klar an, ob Sie den Weg als Fußgänger, Radfahrer oder beides nutzen dürfen und ob Sie ihn benutzen müssen. So können Sie sich richtig verhalten und tragen zur Sicherheit im Straßenverkehr bei.
Welche Rolle spielt die Beweislast bei einem Verkehrsunfall, insbesondere wenn ein Unfallbeteiligter verstorben ist?
Bei einem Verkehrsunfall geht es oft darum, wer für den entstandenen Schaden verantwortlich ist. Im Zivilrecht, also wenn eine Person oder Versicherung von einer anderen Schadensersatz verlangt, gilt grundsätzlich ein wichtiger Grundsatz: die Beweislast.
Das bedeutet: Wer etwas von einem anderen fordert – zum Beispiel die Zahlung von Schadensersatz nach einem Unfall –, muss die Tatsachen beweisen, die seinen Anspruch begründen. Stellen Sie sich vor, Sie behaupten, jemand habe Ihnen durch sein falsches Verhalten einen Schaden zugefügt. Dann müssen Sie beweisen, dass diese Person sich tatsächlich falsch verhalten hat (z.B. eine rote Ampel überfahren hat) und dass dadurch Ihr Schaden entstanden ist. Man spricht hier von der Beweislast des Anspruchstellers.
Herausforderungen ohne Zeugen oder bei verstorbenen Beteiligten
Diese Beweislast kann sehr schwierig werden, besonders wenn es keine Zeugen gibt und ein Unfallbeteiligter verstorben ist. Derjenige, der den Schaden geltend machen möchte, kann dann die andere Seite nicht mehr direkt befragen, und es gibt niemanden, der den Unfallhergang aus erster Hand schildern kann, außer der überlebenden Person.
Die Aufgabe, den Hergang und das mögliche Fehlverhalten des nun verstorbenen Beteiligten zu beweisen, bleibt dennoch bestehen. Gerichte müssen in solchen Fällen versuchen, den Unfall anhand der verfügbaren objektiven Beweismittel zu rekonstruieren. Dazu gehören zum Beispiel:
- Schäden an den Fahrzeugen
- Spuren auf der Fahrbahn (Bremsspuren, Schleifspuren)
- Die Endpositionen der Fahrzeuge nach dem Unfall
- Möglicherweise vorhandene Fotos oder Videos (z.B. aus Dashcams, Überwachungskameras, von Ersthelfern)
- Gutachten von Sachverständigen, die diese Spuren analysieren
Wenn aber trotz aller Bemühungen und der Untersuchung aller Spuren der genaue Unfallhergang nicht mehr festgestellt werden kann oder die Schuld des verstorbenen Beteiligten nicht bewiesen werden kann, führt das oft dazu, dass derjenige, der Schadensersatz verlangt, mit seinem Anspruch keinen Erfolg hat. Denn der Grundsatz bleibt: Wer den Anspruch geltend macht, trägt die Beweislast. Fehlen die Beweise, kann der Anspruch nicht durchgesetzt werden. Der Tod eines Unfallbeteiligten oder das Fehlen von Zeugen ändert an dieser grundsätzlichen Verteilung der Beweislast nichts, macht das Beweisen aber oft erheblich schwerer oder sogar unmöglich.
Welche Ansprüche auf Schmerzensgeld und Schadensersatz können Radfahrer nach einem Unfall geltend machen?
Wenn Radfahrer unverschuldet in einen Unfall geraten, können sie unter bestimmten Umständen finanzielle Ansprüche gegen den Verursacher oder dessen Versicherung haben. Man unterscheidet hierbei grundsätzlich zwei Hauptarten von Schäden, die ersetzt werden können: materielle Schäden und immaterielle Schäden.
Schadensersatz für materielle Schäden
Materielle Schäden sind Schäden, die einen greifbaren, finanziellen Wert betreffen. Sie zielen darauf ab, den Zustand wiederherzustellen, der ohne den Unfall bestanden hätte. Man spricht hier vom Ausgleich der Vermögensschäden.
Für Sie als Radfahrer könnten dies nach einem Unfall beispielsweise folgende Kosten sein:
- Schäden am Fahrrad und der Ausrüstung: Reparaturkosten oder der Wiederbeschaffungswert für Ihr beschädigtes oder zerstörtes Fahrrad, Helm, Kleidung etc.
- Medizinische Kosten: Arztbesuche, Krankenhausaufenthalte, Medikamente, Therapien, Hilfsmittel (wie Krücken oder Orthesen), die nicht von der Krankenkasse übernommen werden.
- Kosten für die Haushaltshilfe oder Pflege: Wenn Sie wegen Ihrer Verletzungen im Haushalt oder bei der Körperpflege Hilfe benötigen.
- Fahrtkosten: Kosten für Fahrten zu Ärzten, Therapeuten oder Krankenhäusern, die unfallbedingt nötig sind.
- Verdienstausfall: Wenn Sie wegen der Verletzungen nicht arbeiten können und dadurch Einkommen verlieren.
- Sonstige Kosten: Alle weiteren finanziellen Einbußen oder notwendigen Ausgaben, die direkt durch den Unfall verursacht wurden.
Das Ziel des Schadensersatzes ist, dass Sie finanziell so gestellt werden, als hätte der Unfall nie stattgefunden. Alle nachweislich durch den Unfall entstandenen Kosten können prinzipiell ersatzfähig sein.
Schmerzensgeld für immaterielle Schäden
Neben den finanziellen Verlusten kann ein Unfall auch immaterielle Schäden verursachen. Hierzu zählen Schmerzen, Leiden und Beeinträchtigungen der Lebensqualität, die durch die Verletzungen entstehen. Für diese Art von Schäden gibt es das Schmerzensgeld. Es hat eine Ausgleichsfunktion für das erlittene Leid und eine Genugtuungsfunktion gegenüber dem Schädiger.
Schmerzensgeld wird beispielsweise gezahlt für:
- Körperliche Schmerzen
- Psychisches Leid (z.B. Angstzustände, Schlafstörungen)
- Dauerhafte Beeinträchtigungen (z.B. Narben, Bewegungseinschränkungen, psychische Folgen)
- Verlust von Lebensfreude oder Hobbys
- Notwendigkeit medizinischer Behandlungen oder Operationen
Die Höhe des Schmerzensgeldes wird nicht einfach nach einer festen Formel berechnet. Sie hängt von vielen verschiedenen Faktoren ab und wird im Einzelfall ermittelt. Wichtige Kriterien sind dabei:
- Schwere und Art der Verletzungen
- Dauer der medizinischen Behandlung
- Dauer und Intensität der Schmerzen
- Eventuelle dauerhafte Folgen der Verletzungen
- Anzahl und Schwere von Operationen
- Dauer der Arbeitsunfähigkeit oder Beeinträchtigung im Alltag
Um eine angemessene Höhe zu finden, orientieren sich Gerichte oft an sogenannten Schmerzensgeldtabellen. Das sind Sammlungen von Urteilen aus ähnlichen Fällen. Diese Tabellen dienen aber nur als Orientierungshilfe, jeder Fall wird individuell betrachtet.
Schmerzensgeldrente bei schweren Folgen
In Fällen, in denen die unfallbedingten Verletzungen besonders schwerwiegend sind und zu dauerhaften, erheblichen Beeinträchtigungen führen, kann statt oder zusätzlich zu einem einmaligen Schmerzensgeldbetrag auch eine Schmerzensgeldrente zugesprochen werden. Das bedeutet, dass der Verletzte regelmäßig (z.B. monatlich) einen bestimmten Betrag erhält, um die fortlaufenden Beeinträchtigungen auszugleichen. Dies ist oft bei schweren Hirnverletzungen, Querschnittslähmungen oder ähnlichen gravierenden und permanenten Schäden der Fall.
Was bedeutet Mitverschulden und wie wirkt es sich auf die Höhe von Schmerzensgeld und Schadensersatz aus?
Mitverschulden bedeutet im rechtlichen Sinne, dass Sie selbst zu einem Schaden beigetragen haben, der Ihnen entstanden ist. Stellen Sie sich vor, Sie sind in einen Unfall verwickelt, bei dem jemand anderes die Hauptschuld trägt. Wenn Sie aber zum Beispiel zu schnell gefahren sind oder eine rote Ampel übersehen haben und dies ebenfalls zum Unfall beigetragen hat, dann liegt ein Mitverschulden auf Ihrer Seite vor. Es geht also darum, dass der Geschädigte das Schadensereignis oder dessen Ausmaß durch eigenes Verhalten beeinflusst hat.
Wann liegt Mitverschulden vor?
Mitverschulden kann in vielen Situationen auftreten, nicht nur bei Verkehrsunfällen. Es liegt vor, wenn Ihr eigenes Verhalten – sei es ein aktives Tun oder auch das Unterlassen einer notwendigen Handlung – dazu beiträgt, dass Ihnen ein Schaden entsteht oder sich verschlimmert. Das Gesetz spricht davon, dass der Geschädigte seinen Schaden selbst zu vertreten hat (§ 254 des Bürgerlichen Gesetzbuchs – BGB). Dies kann zum Beispiel der Fall sein, wenn Sie eine Sorgfaltspflicht verletzen, die dazu dienen soll, Schäden zu vermeiden, oder wenn Sie es versäumen, den Schaden gering zu halten, nachdem er bereits entstanden ist (Schadensminderungspflicht).
Wie wirkt sich Mitverschulden auf Schadensersatz und Schmerzensgeld aus?
Wird ein Mitverschulden festgestellt, hat dies direkte Auswirkungen auf Ihre Ansprüche auf Schadensersatz und Schmerzensgeld. Der Grundgedanke ist: Wer selbst einen Teil zur Entstehung seines Schadens beigetragen hat, soll nicht die volle Wiedergutmachung von der Gegenseite verlangen können.
- Schadensersatz: Wenn Mitverschulden vorliegt, wird der Betrag, den Sie als Schadensersatz für Reparaturen, Arztkosten, Verdienstausfall etc. erhalten würden, gekürzt. Die Kürzung richtet sich nach dem Grad Ihres Mitverschuldens im Vergleich zum Verschulden der anderen Partei.
- Schmerzensgeld: Auch das Schmerzensgeld, das Sie als Ausgleich für erlittene körperliche und seelische Leiden erhalten, wird bei Mitverschulden reduziert. Auch hier spielt der Anteil Ihres eigenen Beitrags am Geschehen eine entscheidende Rolle.
Wie bewertet das Gericht das Mitverschulden?
Das Gericht prüft alle Umstände des Einzelfalls sehr genau. Es wird das Verhalten beider Beteiligten bewerten und gegeneinander abwägen. Dabei wird festgestellt, wer in welchem Umfang für den entstandenen Schaden verantwortlich ist.
Das Gericht berücksichtigt unter anderem:
- Den Grad des Verschuldens jeder Partei (z.B. grobe Fahrlässigkeit, einfache Fahrlässigkeit).
- Den Verursachungsbeitrag des jeweiligen Verhaltens zum konkreten Schaden.
Auf Basis dieser Bewertung legt das Gericht eine sogenannte Haftungsquote fest. Diese Quote drückt aus, zu welchem Prozentsatz jede Partei für den Schaden haftet. Wenn zum Beispiel eine Haftungsquote von 25 % auf Ihrer Seite und 75 % bei der Gegenseite festgestellt wird, bedeutet das, dass Sie nur 75 % Ihres Gesamtschadens ersetzt bekommen, da Sie 25 % selbst mitverursacht haben. Das Gericht muss dabei immer eine umfassende Abwägung vornehmen, um eine gerechte Lösung zu finden, die allen Umständen Rechnung trägt.
Hinweis: Bitte beachten Sie, dass die Beantwortung der FAQ Fragen keine individuelle Rechtsberatung darstellt und ersetzen kann. Alle Angaben im gesamten Artikel sind ohne Gewähr. Haben Sie einen ähnlichen Fall und konkrete Fragen oder Anliegen? Zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren – Fragen Sie unverbindlich unsere Ersteinschätzung an.
Glossar – Fachbegriffe kurz erklärt
Rechtsfahrgebot
Das Rechtsfahrgebot ist eine Regel aus der Straßenverkehrsordnung (§ 2 Abs. 2 StVO), die besagt, dass alle Verkehrsteilnehmer, also auch Radfahrer, grundsätzlich möglichst weit rechts fahren müssen. Ziel dieser Regel ist es, den Verkehr sicher und geordnet zu leiten, indem jeder auf seiner Fahrbahn- oder Wegseite bleibt. Ein Verstoß gegen das Rechtsfahrgebot kann als schuldhaftes Verhalten gewertet werden und haftungsrelevant sein, besonders bei Unfällen. Beispiel: Zwei Radfahrer begegnen sich auf einem engen Radweg; beide müssen rechts fahren, um Kollisionen zu vermeiden.
Beweislast
Die Beweislast bestimmt, wer im Streitfall die Tatsachen darlegen und beweisen muss, die seinen Anspruch begründen. Im zivilrechtlichen Unfallregress trägt der Anspruchsteller, hier der verletzte Radfahrer, die Beweislast dafür, dass der Unfall durch ein schuldhaftes Verhalten des Gegners verursacht wurde. Das ist besonders schwierig, wenn ein Unfallbeteiligter verstorben ist oder keine Zeugen vorhanden sind. Beispiel: Ein Radfahrer fordert Schadensersatz und muss belegen, dass der andere Fahrer das Rechtsfahrgebot verletzt und dadurch den Unfall verursacht hat.
Sorgfaltspflichtverletzung
Sorgfaltspflicht bedeutet, dass jeder Verkehrsteilnehmer die erforderliche Aufmerksamkeit und Vorsicht walten lassen muss, um Gefahren zu vermeiden (§ 823 Abs. 1 BGB). Eine Sorgfaltspflichtverletzung liegt vor, wenn jemand diese Pflicht missachtet und dadurch einen Schaden verursacht, etwa durch falsches Fahrverhalten. Im Unfallkontext ist diese Verletzung eine Voraussetzung für Schadensersatzansprüche. Beispiel: Ein Radfahrer weicht nicht ausreichend nach rechts aus und kollidiert mit einem anderen Radfahrer, der ordnungsgemäß fährt.
Mitverschulden
Mitverschulden liegt vor, wenn der Geschädigte selbst in einem gewissen Umfang zum Schaden beiträgt (§ 254 BGB). Das bedeutet, dass die Ansprüche auf Schadensersatz und Schmerzensgeld gekürzt werden können, je nachdem wie stark der Geschädigte den Unfall mitverursacht hat. Dabei wird eine Haftungsquote festgelegt, die den Anteil der Schuld jeder Partei bestimmt. Beispiel: Ein Radfahrer benutzt entgegen der Verkehrsregeln die linke Seite des Radwegs und wird deshalb teilweise selbst für den Unfall verantwortlich gemacht.
Gesamtschuldnerische Haftung
Gesamtschuldnerische Haftung bedeutet, dass mehrere Personen oder Parteien gemeinsam für die gesamte Schuld haften (§ 421 BGB). Im Unfallfall können beispielsweise die Erben des verstorbenen Unfallverursachers und dessen Haftpflichtversicherer gesamtschuldnerisch für Schadensersatzansprüche in Anspruch genommen werden. Das heißt, der Geschädigte kann von jedem Schuldner die volle Leistung verlangen, und diese müssen untereinander regeln, wer welchen Anteil trägt. Beispiel: Nach einem Unfall verlangen die Verletzten von den Erben des Verstorbenen und seiner Versicherung gemeinsam Schmerzensgeld.
Wichtige Rechtsgrundlagen
- § 823 Abs. 1 BGB (Bürgerliches Gesetzbuch): Regelt die Haftung für unerlaubte Handlungen, insbesondere Schadensersatz bei Verletzung von Rechtsgütern wie Körper oder Eigentum durch eine schuldhafte Pflichtverletzung. Der Anspruchsteller muss ein schuldhaftes Verhalten des Schädigers beweisen. | Bedeutung im vorliegenden Fall: Der Radfahrer machte Schadensersatzansprüche wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung geltend, konnte jedoch das schuldhafte Verhalten des Pedelec-Fahrers nicht nachweisen, weshalb ein Anspruch scheiterte.
- § 2 Abs. 2 StVO (Straßenverkehrsordnung): Verpflichtet Verkehrsteilnehmer, möglichst weit rechts zu fahren, um Gefährdungen anderer zu vermeiden. Diese Regel gilt auch auf Radwegen. Ein Verstoß begründet eine Sorgfaltspflichtverletzung. | Bedeutung im vorliegenden Fall: Das Gericht prüfte, ob der Pedelec-Fahrer gegen das Rechtsfahrgebot verstoßen hat; da dies nicht sicher festgestellt werden konnte, entfiel eine Haftung der Erben.
- § 286 ZPO (Zivilprozessordnung): Bestimmt die freie Beweiswürdigung durch das Gericht und legt fest, dass eine Überzeugung von den Tatsachen nur bei überzeugender Beweisführung möglich ist. | Bedeutung im vorliegenden Fall: Die Angaben des Radfahrers allein reichten nicht aus, um das Gericht von der Schuld des Pedelec-Fahrers zu überzeugen, weshalb Ansprüche abgewiesen wurden.
- § 141 ZPO: Reguliert die Anhörung der Parteien als Beweismittel, welche aber keine förmliche Beweisaufnahme darstellt und bei widersprüchlichen Aussagen geringere Beweiskraft hat. | Bedeutung im vorliegenden Fall: Die persönliche Anhörung des Radfahrers konnte nicht als ausreichender Beweis für die Unfallursächlichkeit des Pedelec-Fahrers herangezogen werden.
- §§ 7, 17 StVG (Straßenverkehrsgesetz): Regeln die Gefährdungshaftung für Kraftfahrzeug-Halter, die bei Unfällen kraftfahrzeugbedingte Schäden haften. | Bedeutung im vorliegenden Fall: Diese Vorschriften waren nicht anwendbar, weil Pedelec und Fahrrad keine Kraftfahrzeuge im Sinne des StVG sind; daher waren deliktische Ansprüche nach BGB relevant.
- § 520 Abs. 3 ZPO: Regelt die Anforderungen an die Berufungsbegründung, insbesondere die Verpflichtung zu ausreichenden Argumenten zur Bestreitung der vorinstanzlichen Entscheidung. | Bedeutung im vorliegenden Fall: Die Berufung gegen den Haftpflichtversicherer wurde als unzulässig verworfen, weil die Begründung nicht genügte.
Das vorliegende Urteil
Oberlandesgericht Hamm – Az.: 7 U 12/23 – Urteil vom 17.01.2025
* Der vollständige Urteilstext wurde ausgeblendet, um die Lesbarkeit dieses Artikels zu verbessern. Klicken Sie auf den folgenden Link, um den vollständigen Text einzublenden.